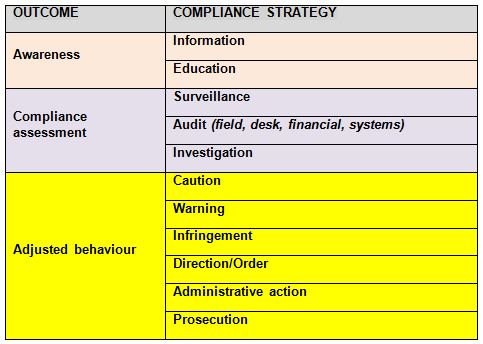Kommunikationsstrategie zur Verbesserung des Verständnisses und der Unterstützung für die Hochwasserprävention
Kommunikation über das Hochwasserschutzpotenzial des Heerener Mühlback, um die Beteiligten zu überzeugen
Source: Anke Althoff, Lippeverband
In den Jahren 2007 bis 2010 kam es in verschiedenen Städten der Emscher- und Lipperegion zu schweren Sturzfluten aufgrund von extremen Niederschlagsereignissen. In der anschließenden öffentlichen Diskussion kam die Frage nach der Verantwortung auf. Bürgerinnen und Bürger formulierten die Forderung, dass die öffentliche Hand, insbesondere die Kommunen und Wasserverbände, einen umfassenden Schutz vor zukünftigen Hochwasserereignissen gewährleisten müssten. Bei der Weiterentwicklung dieser Forderung wurde schnell klar, dass dies nicht möglich sein würde, ohne einen hohen Preis zu zahlen. Es stellten sich Fragen wie: Wie hoch sollten die Deiche sein, und wie groß sollten die Abwasserkanäle dimensioniert werden, um die Menschen vor jedem Extremereignis zu schützen? Wie viel Energie und Geld würde das kosten? Dies würde allen Bemühungen um Klimaschutz und Reduzierung der Treibhausgasemissionen zuwiderlaufen. Eine Kommunikationsstrategie war also notwendig, um die Sichtweise der Bürger zu ändern und Unterstützung für eine vernünftige Lösung zu entwickeln. Ziel war es, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es keine behördliche Lösung gibt, die einen hundertprozentigen Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels bieten kann, und dass immer ein gewisses Maß an Eigenverantwortung bestehen bleiben wird. Dies war der Ausgangspunkt, als die Menschen begannen, die Frage zu stellen: Was kann ich tun?
Die Tatsache, dass die Menschen um ihr Wohlergehen besorgt waren, unterstützte die Kommunikationsstrategie. Ohne die extremen Niederschlagsereignisse. Es wäre viel schwieriger gewesen, mit den Menschen in einen gemeinsamen Dialog über mögliche Ansätze zur Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels zu kommen. Wenn es um das Klima geht, gibt es kein Verursacherprinzip, sondern es sind offene Diskussionen über die Frage, wer was tun kann, erforderlich.
Kommunikationsstrategien, die auf Geschichten aufbauen, die dem Publikum Angst machen sollen, sind nicht erfolgreich. Weder die politischen Entscheidungsträger noch die Menschen gehen gerne von der Annahme aus, dass ihre Welt überflutet und beschädigt werden wird. Eine offene und sachliche Information der Bürger, ergänzt durch die Hervorhebung der potenziellen positiven Auswirkungen von Anpassungsmaßnahmen, kann jedoch ein starker und erfolgreicher Ansatz sein. In diesem Fall hat die Hervorhebung der Vorteile einer höheren Lebensqualität, verbesserter Erholungsmöglichkeiten und eines gesunden Ökosystems die Interessenvertreter und Bürger davon überzeugt, selbst aktiv zu werden und die geplanten EbA-Maßnahmen zu unterstützen.