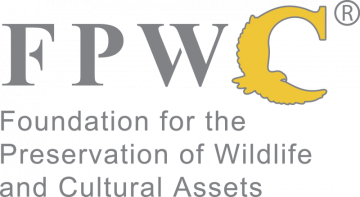
Kaukasus Wildlife Refuge: Pionierarbeit für den privaten Naturschutz in Armenien

Das Caucasus Wildlife Refuge (CWR) ist ein privates Schutzgebiet, das vom FPWC verwaltet wird. Das Refugium, das seit 2010 von 400 auf 20000 Hektar angewachsen ist, erstreckt sich entlang der Grenze des staatlichen Naturschutzgebiets Khosrov Forest (Kategorie IUCN Ia). Das übergeordnete Ziel des CWR ist es, durch die Verbesserung der Schutzmaßnahmen in den bisher nicht nachhaltig bewirtschafteten Pufferzonen und Wildtier-Migrationskorridoren des Reservats zu einem effizienten Schutz der biologischen Vielfalt in Armenien beizutragen. Dies geschieht durch die Verknüpfung von nachhaltiger Gemeindeentwicklung, Naturschutz und Verhaltensänderung.
FPWC unterhält in dem Gebiet eine ständig besetzte Ranger-Station (6 Ranger sind aus der Gemeinde angestellt), die ausreichend ausgestattet ist, um das Gebiet gegen jegliche negative menschliche Einflüsse zu schützen. Die Ranger patrouillieren rund um die Uhr auf den 8000 Hektar, um illegale Aktivitäten in dem Gebiet zu verhindern, und überwachen die Tiere mit Hilfe neuester Technologien. Das CWR ist das einzige Projekt dieser Art im gesamten Südkaukasus.
Kontext
Angesprochene Herausforderungen
Der derzeitige Stand der Naturschutzpraktiken in Armenien ist das Ergebnis jahrzehntelanger Landzuweisungen, Politiken und Bewirtschaftung. Die derzeitigen Gesetze, Kodizes und Forstpolitiken sind fast identisch mit ihren Gegenstücken aus der Sowjetzeit. Sie besagen, dass alle Reservate Eigentum des Staates sind und nur vom Staat verwaltet werden dürfen. Die Durchsetzung und Umsetzung der Gesetze und Strategien ist sehr schwach und unentschlossen. Der Überarbeitung und Modernisierung der Umweltgesetze und -politiken wurde in der armenischen Legislative nur geringe Priorität eingeräumt.
Vor allem in den ersten Jahren unserer Arbeit hatten wir immer wieder mit der mangelnden Bereitschaft der ländlichen Gemeinden zur Zusammenarbeit zu kämpfen, die auf Misstrauen und mangelndem Verständnis dafür zurückzuführen ist, wie sie zum Umweltschutz beitragen können. Diese Mentalität wurde durch die jahrzehntelange Abkopplung vom aktiven Engagement für den Schutz und die Verwaltung von Naturschutzgebieten verursacht.
Illegale Jagd, illegaler Holzeinschlag und unregulierte Weidehaltung sind nach wie vor ein Problem.
Standort
Prozess
Zusammenfassung des Prozesses
In Arbeit.
Bauklötze
Regenerierung nachhaltiger Gemeinschaften
Während der Sowjetzeit und nach der Unabhängigkeit wurden die armenische Gesellschaft im Allgemeinen und die ländlichen Gemeinden im Besonderen immer wieder davon abgehalten, sich aktiv am Schutz und der Verwaltung von Naturschutzgebieten zu beteiligen.
In Anerkennung der dringenden Notwendigkeit, dass die in der Nähe von Schutzgebieten lebenden Gemeinden sich aktiv an der Erhaltung der Ressourcen, von denen sie abhängen, beteiligen und davon profitieren, leistet das FPWC seit 2006 einen konsequenten Beitrag zur ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Gemeinden und bezieht sich damit auf alle vier Dimensionen der Nachhaltigkeit.
Das Gemeindeentwicklungsprojekt fördert eine neue nachhaltige Entwicklungsstrategie für die Dörfer in ganz Armenien, wobei der Schwerpunkt auf den an das CWR angrenzenden Gebieten liegt.
Es zielt darauf ab, die Lebensgrundlagen der Landbevölkerung zu verbessern und eine nachhaltige ländliche Entwicklung als ganzheitlichen Ansatz zu fördern. Diese Strategie verbindet wirtschaftliche und infrastrukturelle Verbesserungen mit Natur- und Umweltschutz, indem sie den Bewohnern abgelegener Dörfer Anreize und Möglichkeiten bietet, durch die nachhaltige Nutzung/Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen Einkommen zu erzielen.
Ermöglichende Faktoren
Das Vertrauen der Gemeinden durch nachweislich positive Auswirkungen in den Gemeinden zu gewinnen, ist ein wichtiger Faktor. Parallel zur Naturschutzarbeit hat FPWC in Dutzenden von Gemeinden erneuerbare Energielösungen eingeführt, Infrastrukturen für Trink- und Bewässerungswasser gebaut/renoviert, Kapazitäten aufgebaut und Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten für die Gemeinden geschaffen. Dies und vieles mehr hat in hohem Maße dazu beigetragen, das Vertrauen in die Naturschutzarbeit von FPWC zu stärken, die Bereitschaft zu lernen, zu verstehen und einen Beitrag zu leisten, Mitgefühl und Solidarität.
Gelernte Lektion
Misstrauen und Widerstand entwickelten sich vor dem Hintergrund von Faktoren wie der Rolle der Regierung als alleiniger Eigentümer der Naturschutzgebiete, der zentralisierten Verwaltung, der mangelnden Berücksichtigung lokaler und gesellschaftlicher Beiträge zur Naturschutzplanung und -verwaltung sowie der Korruption und der mangelnden Aufmerksamkeit der Gesetzgeber für den Umweltsektor - dies waren die größten Herausforderungen, mit denen FPWC konfrontiert war, als es sich den Gemeinden mit einem Angebot zur Partnerschaft und Beteiligung näherte.
Während die CWR wächst, braucht die Einbindung der Gemeinden immer noch Zeit und Konsequenz, aber es ist nur so lange kompliziert, bis das "erste Eis schmilzt". Dann wird es ansteckend und verwandelt sich in eine wachsende Welle, die sich ihren eigenen Weg bahnt.
Nachdem FPWC vor mehr als 10 Jahren mit der Arbeit in einigen wenigen Gemeinden begann, ihnen geduldig die Vorteile des Naturschutzes vermittelte, verschiedene lokal angepasste Methoden anwandte und sich mit Misstrauen und Widerstand auseinandersetzte, sind wir nun an einem Punkt angelangt, an dem sich immer mehr Gemeinden aus eigener Initiative für eine Zusammenarbeit entscheiden und ihr Engagement für gemeinsame Ideen und ihre Bereitschaft, in deren Umsetzung zu investieren, zum Ausdruck bringen.
Änderung des Gesetzes
Auf dem IUCN-Weltkongress 2016 war FPWC Mitverfasser des Antrags 37 zur Unterstützung privater Schutzgebiete, der eines der meistdiskutierten Dokumente des Kongresses war und mit einer Mehrheit der Stimmen angenommen wurde. Dies war ein entscheidender Schritt in den Bemühungen des FPWC, die armenische Regierung dazu zu bewegen, eine Politik zu verabschieden, die private Schutzgebiete als wichtigen Beitrag zu den nationalen und internationalen Erhaltungszielen anerkennt, fördert und überwacht und Mechanismen zur Integration privater Schutzgebiete in das nationale System einführt. FPWC setzt sich weiterhin für rechtliche und finanzielle Anreize für die Erhaltung und Stärkung von privaten Schutzgebieten ein, damit die entsprechende Kategorie im Gesetz der Republik Armenien über besonders geschützte Naturgebiete hervorgehoben wird.
Seit 2015 hat FPWC in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzministerium einen spürbaren Beitrag zur Ausarbeitung eines Änderungspakets für das Fauna-Gesetz der Republik Armenien geleistet.
FPWC ist Mitglied des APS+-Überwachungssystems für internationale Umweltkonventionen und -protokolle wie CBD oder CITES.
Ermöglichende Faktoren
Die Zusammenarbeit, die Kohärenz und die konstruktive Herangehensweise mit staatlichen Institutionen wie dem Ministerium für Naturschutz und internationalen Organisationen wie der Europäischen Union waren ein Schlüsselfaktor für den Erfolg in diesem Segment.
Gelernte Lektion
Die Zusammenarbeit mit der Regierung ist nicht einfach, aber ein notwendiger Bestandteil, um die durchgeführten Arbeiten zu sichern und sie offiziell anerkennen zu lassen.
Auswirkungen
Während es 2010 in dem Gebiet fast keine Wildtiere gab - vor allem wegen der illegalen Jagd -, zeigen die über das gesamte CWR verteilten Fangkameras nun eine wachsende Zahl seltener und auf der Roten Liste stehender Tiere wie Bezoar-Steinböcke, Braunbären, Bartgeier und Steinadler sowie weit verbreitete Arten wie den kaukasischen Luchs, Marder, Dachse, graue Wölfe, Füchse und Hasen.
Im Jahr 2013 entdeckten die Fangkameras einen männlichen Kaukasusleoparden(Panthera pardus saxicolor).
FPWC hat den CWR mit dem Zoo von Eriwan verbunden, um ein einzigartiges regionales Zentrum für die Zucht und Wiederansiedlung seltener südkaukasischer Tierarten zu schaffen.
Die im CWR errichtete Öko-Lodge dient dazu, die lokale Bevölkerung zu umweltfreundlichen und nachhaltigen Praktiken zu befähigen. Das Zentrum bietet Unterkünfte für Ökotouristen sowie für einheimische und internationale Studenten/Wissenschaftler, die in dem Gebiet Feldforschung betreiben.
Ländliche Gemeinden werden in die Erhaltungsbemühungen von FPWC einbezogen und profitieren direkt davon, z. B. durch jährliche Pachtgelder für den Gemeindehaushalt, (Selbst-)Beschäftigungsmöglichkeiten, erneuerbare Energielösungen in den Gemeindegebäuden, ein verbessertes Wasserversorgungsnetz bzw. Zugang zu Trink- oder Bewässerungswasser, Entwicklung des ökologischen Landbaus usw.
SunChild-Öko-Clubs (seit 2006) binden Kinder und Jugendliche in Naturschutzmaßnahmen ein, indem sie Theorie und Praxis im Rahmen des ursprünglichen Lehrplans miteinander verbinden.
Begünstigte
Der ganzheitliche Ansatz von FPWC umfasst verschiedene gezielte Projekte für ländliche Gemeinden, Kinder und Jugendliche, Frauen, lokale und staatliche Behörden, Landwirte, wissenschaftliche und Bildungseinrichtungen. Alle Projekte sind so konzipiert, dass sie den Wildtieren zugute kommen.
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Geschichte

Im Jahr 2017 schenkte Vardahovit, ein kleines Dorf im Südosten Armeniens, dem FPWC 2000 Hektar Gemeindeland für die Ewigkeit. Dieser Fall ist insofern besonders, als ein großes Bergbauunternehmen seit 2016 auf dem Gemeindeland Geoprospektionsarbeiten für polymetallische Erze durchführte. Die Gemeinde beschloss daraufhin, das finanzielle Angebot des Unternehmens für die Verpachtung des Landes abzulehnen und das Land dem FPWC zum Schutz zu schenken. Das neu erworbene Land muss überwacht werden, da das Gebiet Teil des Wildtierkorridors ist. FPWC wird nachhaltigen Tourismus, biologische Landwirtschaft und Kleinunternehmen in der Gemeinde entwickeln, indem es die Kapazitäten der Einheimischen stärkt und neue Einkommensmöglichkeiten für Bauern und Gemeindebewohner schafft.
Ein weiteres Beispiel ist Gnishik, eine kleine Gemeinde in der Provinz Vayots Dzor, die sich trotz des vielfältigen Drucks, das Gemeindeland als Jagdgebiet an lokale Oligarchen zu verpachten, dazu entschlossen hat, das Land dem FPWC zu schenken. Die Gemeinde verfügt über eine äußerst wertvolle biologische Vielfalt. Es sind 889 Pflanzen aufgelistet, von denen 47 auf der Roten Liste stehen. Außerdem zählt die Flora 48 endemische Pflanzen für den Kaukasus und Transkaukasien, von denen 16 armenische Endemiten sind. Die Fauna zählt 151 Wirbeltiere und 217 wirbellose Tiere, von denen 57 Arten im Roten Buch Armeniens aufgeführt sind, darunter die armenische Viper, die Bezoar-Ziege, das armenische Mufflon, die europäische Wildkatze, der kaukasische Leopard, die transkaukasische Wasserspitzmaus, die Hufeisennase, der Braunbär usw. Um sich ein vollständiges Bild von der biologischen Vielfalt im Gnishik-Gebiet zu machen, müssen umfassende Studien, Forschungs- und Überwachungsarbeiten durchgeführt werden. Die Bürgermeister beider Gemeinden unterstützen die Arbeit des FPWC und setzen sich für die Bekämpfung der Wilderei und die Erhaltung der Artenvielfalt ein.





