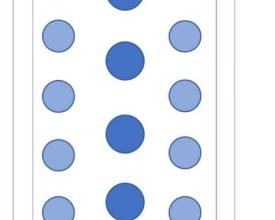Sanierung von Windschutzanlagen

Dieses Best-Practice-Beispiel beschreibt Windschutzstreifen als integrierten Ansatz zur Steigerung der Bodenproduktivität und der Artenvielfalt auf verschiedenen Ebenen. Windschutzstreifen sind eine bekannte Maßnahme gegen Winderosion. Sie bestehen aus Reihen von Bäumen und Sträuchern entlang der Ränder von landwirtschaftlichen Feldern, um den Mutterboden vor starken Winden zu schützen. Der Ansatz wurde in Ostgeorgien zwischen 2009 und 2019 im Rahmen der Programme "Nachhaltiges Management der Biodiversität, Südkaukasus" und "Integriertes Biodiversitätsmanagement, Südkaukasus" umgesetzt. Im Rahmen dieser Projekte wurden 11 km lange Windschutzstreifen saniert und neu angelegt, wobei Bäume und Sträucher in einer Breite von 10 m gepflanzt wurden. Zu den Baumarten gehörten Mandel, Chinabaum, russische Olive, Pistazie, Wildbirne, Wildaprikosen, Robinie, Gemeine Esche, Kaukasus-Hackbeere, Eldar-Kiefer und Feldulme. Diese Baumarten wurden nach dem entwickelten Pflanzschema gepflanzt, wobei Techniken zur Vorbereitung des Bodens und der Setzlinge eingesetzt wurden.
Kontext
Angesprochene Herausforderungen
Windschutzstreifen sind ein wichtiges Mittel zur Anpassung an trockene Klimabedingungen und zum Schutz landwirtschaftlicher Felder vor Wind und Bodenerosion. In den 1950-70er Jahren wurden in Shiraki rund 1 800 km Windschutzbäume gepflanzt. Mehr als 90 % davon wurden entweder durch Feuer oder durch illegale Abholzung für Brennholz zerstört. Brände werden von Landwirten verursacht, die Ernterückstände verbrennen, und von Hirten, die Weiden und Windschutzstreifen abbrennen, um das Wachstum von neuem Gras zu fördern und Land zu roden.
Trockenheit, Feuer und Frost, aber auch Verbiss durch (wandernde) Schafe und Rinder sowie illegaler Brennholzeinschlag waren die Hauptschwierigkeiten bei der Wiederherstellung von Windschutzstreifen. Unklare institutionelle und verwaltungstechnische Strukturen in Bezug auf Mandate und Verpflichtungen zur Erhaltung des Windschutzsystems verschlimmern die Situation zusätzlich.
Standort
Prozess
Zusammenfassung des Prozesses
Der hier beschriebene Ansatz umfasst eine schrittweise Anleitung zur Sanierung oder zum Anbau von Windschutzanlagen. Alle Bausteine, die Auswahl des Standorts und die grundsätzliche Gestaltung, die Auswahl der Setzlinge sowie die Pflege und der Schutz, beschreiben Aktivitäten und Anforderungen für die Sanierung von Windschutzanlagen. Sie enthalten eine Abfolge von Aktivitäten, Erfahrungen und Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung.
Der erste Block beginnt mit der Planung und Vorbereitung des Standorts für die Anpflanzung ausgewählter trockenheitsresistenter Busch- und Baumarten. Der Gestaltungsplan legt auch fest, welche Bäume in den mittleren und äußeren Reihen gepflanzt werden sollen.
Der 2. Block zeigt die Auswahl von robusten, an die örtlichen Klimabedingungen angepassten Bäumen und Sträuchern und deren Überlebensrate. Diese Empfehlungen beruhen auf Feldversuchen während der Projektdurchführung und haben sich für das Shiraki-Tal bewährt. Auch die Bewässerung und die Bedingungen für die Anpflanzung von Setzlingen werden in diesem Block beschrieben.
Der dritte Block zeigt die Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analyse und wie ein Verbot des Abbrennens den Schutz der verbleibenden und neu angelegten Windschutzstreifen verbessern kann. Er enthält die nächsten Schritte für die weitere Anpassung an Windschutzstreifen und Bedingungen, die die Nachhaltigkeit des Ansatzes in der Zukunft unterstützen.
Bauklötze
Auswahl der Standorte und grundsätzliche Gestaltung
Das Pflanzschema sollte an die örtlichen Standortbedingungen sowie an den Standort, die Länge und die Breite des Windschutzes angepasst werden. Der Windschutz kann aus drei bis vier Reihen verschiedener Baum- und Straucharten mit einer Gesamtbreite von 10 m und einem Abstand von 400-500 m zwischen ihnen bestehen. Die mittlere Reihe besteht aus großen Bäumen (Robinie, Esche, kaukasische Hackbeere, Feldulme), die äußeren Reihen aus kleineren Bäumen oder Sträuchern (Mandel, Chinabaum, russische Olive, Pistazie, Wildbirne, Wildaprikose). Der Abstand zwischen den Bäumen und Sträuchern beträgt 2-3 m, zwischen den Reihen in Schachordnung 2-3 m.
Ermöglichende Faktoren
Die Setzlinge sollten im Herbst nach einem gut durchdachten Plan gepflanzt werden, wie er in der beigefügten Grafik beschrieben ist. So kann sich die Wurzel eine Zeit lang ausruhen und die Chance auf ausreichende Niederschläge, Regen und Schnee, wird erhöht. Die Pflanzstellen werden so vorbereitet, dass der Wasserfluss gewährleistet ist. Es ist ratsam, während des Winters Schutzrohre zu setzen. Sie bieten einen guten Schutz vor Wind und Tieren und erhöhen die Überlebensrate um mehr als 70 %.
Gelernte Lektion
Der Zwischenfruchtanbau von Gemüse wie Zwiebeln und Kartoffeln in Windschutzstreifen kann gute Ergebnisse bringen und die Menschen dazu ermutigen, Windschutzstreifen zu erhalten und vor Feuer zu schützen.
Auswahl der Setzlinge
Die Windschutzstreifen wurden im Shiraki-Tal neu gepflanzt, um die Winderosion zu bekämpfen. Während der fast zehnjährigen Testphase wurden robuste Bäume und Sträucher mit einer breiten Palette von Arten ermittelt. Für Shiraki wurden einheimische Arten ausgewählt, die sowohl die feuchten als auch die extrem trockenen und heißen Jahre überstanden. Lokale Baumschulen stellten ihre Setzlinge (in Containern) zur Verfügung. Die Liste der Arten mit einer guten Überlebensrate in Shiraki ist nachstehend aufgeführt:
Sträucher für die äußeren Reihen: Amygdalus communis, Überlebensrate: 40-80%; Koelreuteria paniculata, Überlebensrate: 50-90%; Elaeagnus angustifolia, Überlebensrate: 35-70%; Pistacia mutica, Überlebensrate: 70-90%; Pyrus caucasica, Überlebensrate: bis zu 80%, Prunus armeniaca, Überlebensrate: 65-75%.
Bäume für die mittlere Reihe: Robinia pseudoacacia, Überlebensrate: 50-75%; Fraxinus excelsior, Überlebensrate: 40-55%; Celtis australis subsp. caucasica (syn. Celtis caucasica), Überlebensrate: 50-80%; Ulmus minor, Überlebensrate: 50-80%.
Die meisten dieser Bäume und Sträucher tragen Früchte, sind trockenheitstolerant und werden oft gepflanzt, um die Bodenerosion in trockenen Regionen zu bekämpfen.
Junge Setzlinge sollten in den ersten zwei Jahren mindestens 2-4 Mal pro Jahr mit jeweils 5-10 Litern Wasser bewässert werden.
Ermöglichende Faktoren
Das Saatgut wird in größeren Sanierungsgebieten gesammelt (vorzugsweise von Bäumen und Sträuchern, die die letzten Dürreperioden überstanden haben), um eine angemessene Herkunft und Anpassung an die standortspezifischen ökologischen Bedingungen sicherzustellen.
Das Saatgut sollte professionell für die Anpflanzung in einer Baumschule vorbereitet werden.
Gelernte Lektion
Die Versuche zum Anbau von Mandeln und Wildaprikosen durch Aussaat waren erfolgreich. Weniger erfolgreich, aber dennoch empfehlenswert war der Anbau von Pistazien durch Aussaat.
Sämlinge, die über große Entfernungen transportiert werden sollen, sollten in speziellen Behältern gezogen werden, um eine gute Entwicklung des Wurzelsystems zu gewährleisten und Transportschäden zu minimieren. Werden sie in der Nähe des Pflanzortes gezogen und ist die Transportzeit kurz, können die Setzlinge auch wurzelnackt gezogen werden.
Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Pflanzen nach vier Jahren sicher und völlig autark sind.
Wartung und Schutz
Die GIZ führte eine Kosten-Nutzen-Analyse durch, um den Wert des Schutzes verbleibender Windschutzstreifen, die Vorteile von Stroh als Dünger und die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Verbots des Verbrennens von Ernterückständen zu bewerten. Die Erhebungsdaten zeigten, dass ein Verbot des Verbrennens von Ernterückständen dazu beitragen würde, bestehende Windschutzstreifen zu schützen. Durch das Zerkleinern des Strohs bei der Ernte und die anschließende Einarbeitung des Strohs in den Boden wird organisches Bodenmaterial aufgebaut, das dazu beiträgt, Feuchtigkeit im Boden zu speichern. Durch die Erhöhung des Kohlenstoffgehalts im Boden wird die Fruchtbarkeit des Bodens gesteigert. Der Kohlenstoffgehalt des Bodens ist ein wichtiger Indikator für die Überwachung der Neutralität der Bodendegradation (LDN).
Unklare Eigentumsverhältnisse und institutionelle Verantwortung sind die Haupthindernisse für die Schaffung von Nachhaltigkeit bei Windschutzanlagen. Auf politischer Ebene hat eine Arbeitsgruppe im Rahmen des Nationalen Forstprogramms die Wiederherstellung von Windschutzstreifen als zentrales Thema gewählt. Mit Unterstützung der GIZ entwickelte das Ministerium für Umweltschutz und Landwirtschaft eine Politik für die Wiederherstellung und den Schutz von Windschutzgebieten. Darauf aufbauend wurde ein neues Gesetz über Windschutzstreifen auf den Weg gebracht, um die Situation zu klären und klare Verantwortlichkeiten für die Pflege und das Management von Windschutzstreifen festzulegen. Das Gesetz befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase im Agrarausschuss des georgischen Parlaments.
Ermöglichende Faktoren
Um die Nachhaltigkeit der Windschutzsanierung zu gewährleisten, sind diese Schritte wichtig:
- Offizielle Verabschiedung des neuen Gesetzes über Windschutzstreifen
- Initiierung und Entwicklung eines staatlichen Programms zur Sanierung und zum Schutz von Windschutzgebieten, um einen gewissen Grad an Selbstversorgung in der Weizenproduktion zu gewährleisten (für die nationale Sicherheit)
- Einführung von Alternativen zur landwirtschaftlichen Verbrennung
- Sensibilisierung für die Vorteile und Unterstützung der Landnutzer bei der Nutzung von landwirtschaftlichen Reststoffen (z.B. für Brikettierung, als Stroh für Ställe)
Gelernte Lektion
Es ist wichtig, Brände zu kontrollieren, da sie sich leicht über Felder ausbreiten. Wenn die Landwirte weiter brennen, lassen sich die Auswirkungen kaum wirksam eindämmen. Ein gesetzlich verankertes Verbot der Verbrennung oder des Verbrennens von Ernterückständen wird die Landwirte besser vor unvorhersehbaren Bränden in benachbarten Betrieben schützen.
Auswirkungen
Windschutzstreifen schützen das Land vor Winderosion und Trockenheit und tragen zur Steigerung der Ernteerträge und der Holzproduktion bei. Windschutzstreifen bieten Rückzugsgebiete für Pflanzenarten, die empfindlich auf Herbizide und das Pflügen reagieren, sowie Unterschlupf und Bruthabitat für Vögel und kleine Säugetiere, einschließlich Raubtiere von landwirtschaftlichen Schädlingen. Baumstreu verbessert die Bodenbedingungen und wirkt sich positiv auf die Vielfalt der Bodenwirbeltiere aus. Sie verringert die Windgeschwindigkeit bis zu 200 m in das Ackerland hinein, was zu einer geringeren Winderosion des Oberbodens führt und die Bodenproduktivität erhöht. Außerdem verbessern Windschutzstreifen das Mikroklima für die in ihrem Schutz angebauten Pflanzen, indem sie den Feuchtigkeitsverlust verringern.
Die Wiederherstellung von Windschutzstreifen trägt dazu bei, das Shiraki-Tal vor der Umwandlung in Steppen in den kommenden Jahrzehnten zu schützen. Darüber hinaus tragen Windschutzstreifen dazu bei, die Landbewirtschaftung widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu machen.
Begünstigte
Die Nutznießer sind Haushalte und Landwirte, da sich die Windschutzstreifen positiv auf die Ernte- und Holzproduktion auswirken. Die lokale Bevölkerung und die Tierwelt (Vögel, kleine Säugetiere, Insekten) können von den positiven ökologischen und klimatischen Auswirkungen profitieren.