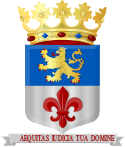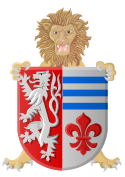Grenzüberschreitende koordinierte Naturentwicklung und Nationalparkerweiterung

Das Projekt konzentriert sich auf Schutzgebiete entlang der deutsch-niederländischen Grenze, die die Gemeinden Roermond, Roerdalen (NL), Wassenberg und Wegberg (D) berühren. Ziel des Projekts war es, eine gemeinsame Nationalparkregion weiterzuentwickeln und ihre gemeinsame Geschichte und ihre heutige Bedeutung herauszustellen. Es sieht die grenzüberschreitende (TB) Verbesserung der Natur- und Landschaftsqualität durch die Verbindung und Aufwertung von Lebensräumen vor. Es wurden eine Vereinbarung über eine gemeinsame Zonierung und ein nachhaltiges Tourismuskonzept entwickelt.
Kontext
Angesprochene Herausforderungen
Standort
Prozess
Zusammenfassung des Prozesses
Bauklötze
Grenzüberschreitende Arbeitsgruppe für Naturschutz
Ermöglichende Faktoren
Gelernte Lektion
Übertragung der Zonierung von Nationalparks zwischen zwei Ländern
Ermöglichende Faktoren
Gelernte Lektion
Koordinierte grenzüberschreitende Maßnahmen zur Verbesserung und Vernetzung von Biotopen
Ermöglichende Faktoren
Gelernte Lektion
Grenzüberschreitender nachhaltiger Tourismus
Ermöglichende Faktoren
Gelernte Lektion
Auswirkungen
Das Projekt umfasste Maßnahmen für eine vielfältigere und verbesserte Zusammenarbeit über die NL-DE-Grenze hinweg, die Ausweitung der Erholungszonen im Nationalpark, ein koordiniertes Habitatmanagement und die Förderung eines nachhaltigen Tourismus. Zu den besonderen Wirkungen gehören: 1) Aufbau von Netzwerken von Freiwilligen und Interessenvertretungen mit den Schwerpunkten Natur, Forstwirtschaft und Tourismus, die eine Grundlage für einen koordinierten Naturschutz auf breiter Ebene bilden; 2) Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Grenzgemeinden, die eine weitere Zusammenarbeit im TB zur Verbesserung der ökologischen und wirtschaftlichen Situation ermöglicht; 3) Verbesserung der Integrität des Ökosystems durch umfassende Wiederherstellung und Aufwertung von Lebensräumen und 4) Verbesserung der touristischen Infrastruktur, die den Bekanntheitsgrad des TB-Gebiets erhöht und damit die lokale Tourismusindustrie und ihre Interessenvertreter unterstützt. Verbesserte Zusammenarbeit, gestärkte TB-Netzwerke und eine gemeinsame Nationalparkzonierung können als Grundlage für weitere TB-Naturschutzmaßnahmen dienen.
Begünstigte
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Geschichte