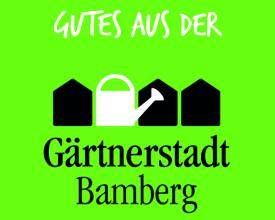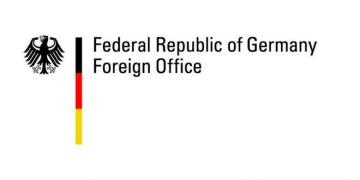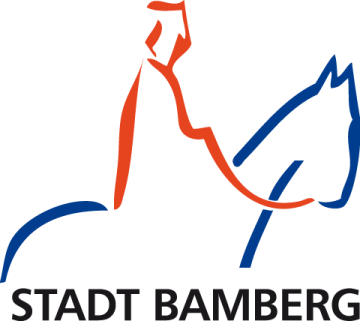
Wiederbelebung des historisch verwurzelten städtischen Gartenbaus in der Welterbestadt Bamberg, Deutschland

Die Stadt Bamberg wurde 1993 unter den Kriterien (ii) und (iv) in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen, da ihre mittelalterliche Anlage und ihre historischen Gebäude erhalten sind. Die Stadt veranschaulicht die Verbindung zwischen der Landwirtschaft (Gärtnereien und Weinberge) und dem städtischen Vertriebszentrum. Das Gärtnerviertel ist ein integraler Bestandteil des Ortes. Die historischen städtischen Gärten wurden jedoch aufgrund der Verteilung unter den Erben nach und nach zersplittert. Familien, die ihre Gärten noch zu gewerblichen Zwecken bewirtschaften, haben es schwer. Im Jahr 2012 fand die BayerischeLandesgartenschau in Bamberg statt und lenkte die Aufmerksamkeit auf das Gärtnerviertel. In diesem Zusammenhang wurde das traditionelle städtische Gärtnern wiederbelebt. Diese Bemühungen wurden mit rund 1,3 Millionen Euro aus dem Nationalen Investitionsprogramm für das Welterbe für Sensibilisierungsmaßnahmen, eine Marketingkampagne und die Umsetzung eines nachhaltigen Landnutzungskonzepts unterstützt. Ein Folgeprogramm wird derzeit entwickelt.
Kontext
Angesprochene Herausforderungen
Soziale und wirtschaftliche Faktoren erschweren die Erhaltung der historischen Stadtgärten Bambergs. Da sich die Anerkennung Bambergs als Welterbe vor allem auf seine architektonischen Werte konzentrierte, wurden die städtischen Gärten, die sich hinter Privathäusern verbergen, oft übersehen. Das Gärtnerviertel ist kein selbsterklärendes Ziel. Die heterogene Eigentümerstruktur des Gebiets begrenzt den Einfluss der Stadt auf seine Entwicklung. Gewerbliche Gärtnereien sind räumlichen Beschränkungen unterworfen, die den Einsatz von Maschinen ausschließen. Hohe Kosten für wichtige Ressourcen wie Wasser stellen ein weiteres Hindernis dar. Gleichzeitig hat der zunehmende Entwicklungsdruck in der Vergangenheit mehrere Bautätigkeiten verlockt, die zum Verlust der biologischen Vielfalt und des traditionellen lokalen Wissens geführt haben.
Standort
Prozess
Zusammenfassung des Prozesses
Die Bausteine sind Teil einer Gesamtstrategie zur Wiederbelebung des historisch gewachsenen urbanen Gärtnerns in der Welterbestadt Bamberg. In ihrer Gesamtheit können die Bausteine ihre Wirkung am besten entfalten und sich gegenseitig verstärken. Der Aufbau von Partnerschaften auf mehreren Ebenen (BB1) zwischen der Stadtverwaltung, Gärtnervereinen, Bildungseinrichtungen und den Bürgern erleichtert die Bewusstseinsbildung (BB2) unter den verschiedenen Akteuren, um ein gemeinsames Verständnis für den Wert des historischen urbanen Gärtnerns und der damit verbundenen traditionellen Praktiken zu erreichen. Ein Erfolgsfaktor ist die Vielfalt der Akteure, wobei den Gärtnern als Wissensträgern eine Schlüsselrolle zukommt. Um eine langfristige Wirkung zu erzielen, werden auch Schulen einbezogen, die einen generationenübergreifenden Ansatz verfolgen. Schließlich wirken die Medien als Multiplikator für die verschiedenen Maßnahmen und tragen langsam dazu bei, dass die Bamberger Gartentradition als gemeinsames Erbe wahrgenommen wird, das es an die nächsten Generationen weiterzugeben gilt. Diese Schritte ermöglichen die Entwicklung einer lokalen Marke (BB3), die die Nachhaltigkeit der Initiative durch das Engagement der Gärtnerinnen und Gärtner sowie das Engagement der lokalen Bevölkerung bei der Rekultivierung städtischer Felder ermöglicht (BB4).
Bauklötze
Partnerschaft auf mehreren Ebenen (Gemeinde, Eigentümer, Verbände, Bürgerinitiativen)
Angesichts der heterogenen Eigentumsverhältnisse im Gärtnerviertel war der Aufbau von Partnerschaften zeitaufwändig. Vertreter der Stadtverwaltung und ihrer Tochtergesellschaften (z.B. die Stadtwerke für die Wasserversorgung) mussten mit Gärtnern, Grundstückseigentümern, Vereinen (wie dem Heritage Garden oder der Licorice Society) und Gartenliebhabern an einen Tisch gebracht werden. Die Stadtverwaltung wandte sich schriftlich und telefonisch an die entsprechenden Interessengruppen und organisierte mehrere Treffen. Die Bedenken der Anwohner hinsichtlich der Privatsphäre mussten sorgfältig berücksichtigt werden, während gleichzeitig geeignete Nutzungsmöglichkeiten für unbebautes Land gefunden werden mussten. In einem Fall führte die Vertrauensbildung kürzlich sogar dazu, dass eine verlassene Gärtnerei in ein Gemeindezentrum umgewandelt wurde, in dem kulturelle Veranstaltungen, Kochkurse und Ausstellungen stattfinden.
Ermöglichende Faktoren
- Bayerische Landesgartenschau , die 2012 in Bamberg stattfand und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Bamberger Gartentradition gelenkt hat
- Breites Interesse an lokaler Lebensmittelproduktion
- Staatliche Förderung durch das Nationale Investitionsprogramm für das Welterbe (2009-2013)
Gelernte Lektion
- Die frühzeitige Einbeziehung der Betroffenen ist entscheidend: Der partizipative Prozess muss bereits bei der Entwicklung von Maßnahmen beginnen, nicht erst bei der Verteilung von Aufgaben.
- Veränderungen brauchen Zeit: Menschen wehren sich von Natur aus gegen Veränderungen. Die Menschen ziehen das Vertraute der Angst vor dem Unbekannten vor. Daher muss ausreichend Zeit eingeplant werden, um die Beteiligten einzubeziehen und sie mental auf das Projekt einzustimmen. Es geht nicht darum, den Widerstand zu beseitigen. Das ist nicht möglich. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Probleme zu äußern - manchmal müssen sie einfach gehört werden.
- Kommunikation ist der Schlüssel: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Beteiligten rechtzeitig mit relevanten Informationen über das Projekt versorgen. Wer sich auf Gerüchte verlässt, zerstört die Vertrauensbasis.
Generationsübergreifender Ansatz zur Sensibilisierung für den Wert historischer Stadtgärten
Während Urban Gardening rund um den Globus in Mode ist, stammt das Bamberger Gärtnerviertel noch aus dem Mittelalter und wurde nicht wie in Bath (Großbritannien) oder Istanbul (Türkei) für den Bau von Wohnhäusern aufgegeben. Diese Einzigartigkeit zieht internationale Forscher und Touristen gleichermaßen an. Die einheimische Bevölkerung hingegen nimmt diese Tatsache als selbstverständlich hin. Das Welterbebüro kommuniziert intensiv das nationale und internationale Interesse an der Einzigartigkeit Bambergs, um das Bewusstsein für den Schutz der lokalen Gartentradition zu stärken. Mehrere Dokumentarfilme des Bayerischen Fernsehens über das Bamberger Gärtnerviertel haben die lokale Identität und den Stolz der Menschen auf die Gärtnertradition gestärkt. Auch die internationalen Delegationen, die Bamberg regelmäßig besuchen, um das einzigartige Gärtnerviertel zu erleben, tragen zum Bewusstsein für den Wert dieses Erbes bei.
In mehreren Familien hat die nächste Generation den Gartenbaubetrieb übernommen. Einige dieser jungen Leute haben sogar einen Sitz im Stadtrat, um sicherzustellen, dass die Interessen der Gärtner auf dem politischen Parkett Gehör finden.
In Bamberg besucht inzwischen jedes Schulkind mindestens einmal das Gärtnereirevier, um die Lebensmittelproduktion vor Ort kennen zu lernen.
Ermöglichende Faktoren
- Bestehende Gärtnereien in historischer Tradition
- Nationales und internationales Interesse am urbanen Gärtnern
- Medienberichterstattung über urbanes Gärtnern
- Interessierte Lehrer und begeisterte Kinder an lokalen Schulen
Gelernte Lektion
- Stellen Sie sicher, dass Sie nicht die örtlichen Gärtner für die Medien nutzen, sondern ihr Wissen und ihre Fähigkeiten würdigen
- Helfen Sie bei der Filmproduktion, um die Zeit der Gärtner nicht zu verschwenden
- Gehen Sie proaktiv auf Lehrer zu
Entwicklung einer Marke für lokale Produkte
Eine Interessengemeinschaft von 19 Gärtnern wurde vom Welterbebüro initiiert. Sie veranstaltet gemeinsame Aktivitäten wie den jährlichen "Tag der offenen Gärtnerei" und veröffentlicht Einkaufsführer für lokale Produkte. Das Konsortium der Gärtner wird von einem Verwalter koordiniert, der aus dem Nationalen Investitionsprogramm für das Welterbe (2009-2013) bzw. von den Gärtnern finanziert wird. Das Konsortium hat ein eigenes Logo, das vor einigen Jahren in Auftrag gegeben wurde und die Aufschrift "Gutes aus der Gärtnerstadt" trägt.
Ermöglichende Faktoren
- Zusammenarbeit zwischen Gärtnern zum Austausch von Marktkenntnissen.
- Finanzmittel für die Markenentwicklung(Nationales Investitionsprogramm für das Welterbe).
- Koordinierung: Über eine gemeinsame Plattform (https://www.gaertnerstadt-bamberg.de/) präsentieren die Gärtner ihr Angebot; regelmäßige Treffen dienen der Vorbereitung des jährlichen Tags der offenen Gärtnerei und der Initiierung weiterer Projekte.
- Die gärtnerischen Produkte (Gemüse, Sträucher, Kräuter, Blumen) variieren von Gärtner zu Gärtner. Dadurch wird der Wettbewerb zwischen ihnen verringert.
Gelernte Lektion
- Erklären Sie den Mehrwert einer konzertierten Aktion/einer gemeinsamen Marke.
- Ein Marketingexperte hat die Stärken und Schwächen des Gärtnerviertels als Einkaufsort untersucht und daraufhin ein Kommunikationskonzept entwickelt. Es basiert auf der Tradition der Gärtnerfamilien und auf der einzigartigen Vielfalt an frischen, nahrhaften Produkten. Der Lokalstolz und das grüne Gewissen der Verbraucher, ihren "Foodprint" durch den Kauf von Lebensmitteln, die in ihrer Gemeinde angebaut wurden, zu reduzieren, dienen ebenfalls als Verkaufsargument.
Rekultivierung städtischer Felder mit traditionellen Kulturpflanzen
Unbebautes Land wurde genutzt, um einen Garten des Kulturerbes mit endemischen Pflanzen anzulegen und Lakritze wieder anzubauen. Der europaweite Handel mit Samen und Süßholzwurzeln war einst ein wichtiger Bestandteil der lokalen Wirtschaft. Die Pflanze wurde für medizinische Zwecke und als Süßungsmittel verwendet. In den 1960er Jahren verlor die Bamberger Süßholzwurzel jedoch ihre Konkurrenzfähigkeit. Entsprechend ist auch das Wissen über Anbau, Ernte und Verarbeitung von Süßholz zurückgegangen. Die Lakritzgesellschaft engagiert sich für die Rekultivierung der Pflanze und versucht, Ernte- und Verarbeitungsmethoden zu rekonstruieren. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit spielt heute keine Rolle mehr. Die Süßholzwurzel ist heute ein Genießerprodukt für Touristen.
Ermöglichende Faktoren
- Engagierte Personen: Einer von ihnen besitzt ein Stück Land; andere sind am Gärtnern interessiert, haben aber keinen Garten für sich.
- Verfügbares Land.
Gelernte Lektion
Das Engagement muss über den anfänglichen Finanzierungszeitraum hinaus aufrechterhalten werden: Das positive Medienecho und das Erleben der Gemeinschaft von Gleichgesinnten beflügelten das weitere Engagement.
Auswirkungen
(1) Es wurde ein rechtsverbindlicher Flächennutzungsplan verabschiedet, um die städtischen Gärtnereiflächen vor Bebauung zu schützen.
(2) Es wurden neue halböffentliche Räume wie der Heritage Garden mit endemischen Pflanzen sowie Süßholzfelder angelegt.
(3) Es wurden Bildungsinitiativen mit Schulkindern gestartet.
(4) Eine starke lokale, nationale und internationale Medienberichterstattung zog junge Menschen an und führte zu solidarischen landwirtschaftlichen Projekten und einem verstärkten touristischen Interesse am Bezirk.
(5) Lokales gärtnerisches Wissen wurde dokumentiert und zugänglich gemacht.
(6) Mit der gestiegenen Sichtbarkeit des Gärtnerviertels und der Bamberger Gartentradition wurde 2014 die Bamberger Gartentradition in das Bayerische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Im Jahr 2016 wurde sie in das Bundesinventar des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.
Begünstigte
Kommune Bamberg, Gärtner, Gärtnervereine: Oberer Gärtnerverein, Unterer Gärtnerverein, Verein Gärtner- und Häckermuseum, Sortengarten e.V., Süßholzgesellschaft, Bildungseinrichtungen, Forscher, Touristen
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Geschichte

Seit dem Mittelalter wird in Bamberg urbanes Gärtnern praktiziert. Das Gärtnerviertel ist zusammen mit der Stadt auf den Hügeln und dem Inselviertel integraler Bestandteil des Welterbes "Stadt Bamberg". Im Jahr 2009 wurde eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, ob die Besitzer von Gärtnereiflächen offen für neue Formen des Gärtnerns sind, die mit den Einschränkungen des Gärtnerviertels vereinbar sind. Die Ergebnisse waren ernüchternd.
Sieben Jahre nach der Umfrage begannen alteingesessene Gärtner mit jungen Familien zusammenzuarbeiten: Im Jahr 2016 - als die Bamberger Gartentradition in das Bundesinventar des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde - startete die lokale Transition-Gruppe ihren ersten Selbstpflückgarten am Stadtrand von Bamberg. Der Filmemacher Christian Beyer hat diese Entwicklung begleitet und die Entstehung des Gemeinschaftsgartens festgehalten. Er hat festgehalten, wie sie ihr eigenes Gemüse in Bio-Qualität anbauen und wie dies ihre Wahrnehmung der Lebensmittelproduktion verändert.
Der Film "Ernten, was man sät" (https://www.youtube.com/watch?v=2PJ6BmU1-Tk) wurde beim Bamberger Kurzfilmfestival 2018 in der Kategorie "Made in Oberfranken" ausgezeichnet. Aktuell baut die lokale Transitionsgruppe einen weiteren Pick-your-own-Garten im historischen Gärtnerviertel auf. (Patricia Alberth, Leiterin des Welterbebüros Bamberg)