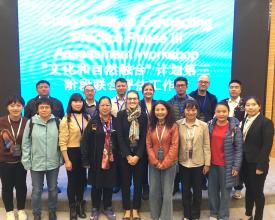Connecting Practice Project, Überbrückung der Kluft zwischen Natur und Kultur im Welterbe

Seit 2013 führen ICOMOS und IUCN das Projekt "Connecting Practice" durch, ein gemeinsames Projekt zur Entwicklung neuer Methoden und Erhaltungsstrategien, die den zusammenhängenden Charakter der natürlichen, kulturellen und sozialen Werte von Welterbestätten anerkennen und erhalten. Das Projekt zielt darauf ab, praktische Strategien für einen stärker integrierten Erhaltungsansatz zu entwickeln, die Koordination zu verbessern und die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Kultur und Natur zu vertiefen, um bessere Erhaltungsergebnisse zu erzielen. Ein ehrgeizigeres Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Kultur und Natur zu erlangen und Veränderungen in den konzeptionellen und praktischen Ansätzen für die Bewertung, die Verwaltung und das Management von Werten im Rahmen der Umsetzung der Welterbekonvention und darüber hinaus zu bewirken. Dieses Gemeinschaftsprojekt ist darauf ausgerichtet, aus der Praxis zu lernen, indem interdisziplinäre Teams mit Mitarbeitern und Partnern von Welterbestätten zusammenarbeiten, die die Verflechtung von Kultur- und Naturerbe veranschaulichen.
Kontext
Angesprochene Herausforderungen
Eine der größten Herausforderungen besteht darin, dass jedes Gut einzigartige natürliche, kulturelle und soziale Werte hat, wobei Management, Governance und Erhaltungsrahmen von der Umgebung und der Organisation des jeweiligen Standorts abhängen. Die Sicherstellung einer ganzheitlichen Betrachtung aller Werte (OUV und andere Werte) und Attribute/Merkmale auf Standort- und institutioneller Ebene ist oft eine Herausforderung.
Connecting Practice verfolgt einen Ansatz des Erfahrungslernens und schafft kurze, intensive Erfahrungen während der Besuche vor Ort. Es ist oft schwierig, zugängliche Ressourcen zu schaffen, die Informationen und Wissen enthalten, die während der Feldbesuche gemeinsam erarbeitet wurden. Die Sicherstellung einer respektvollen und gleichberechtigten Interaktion und von Lernmöglichkeiten für die Teilnehmer an der Feldarbeit und den Besuchen vor Ort beinhaltet die Einbeziehung von lokalen Behörden, nationalen Anlaufstellen, Standortmanagern und Kollegen aus dem Bereich des Natur- und Kulturerbes.
Rückmeldungen deuten auf hohe Erwartungen an das Projekt hin, und die Bewältigung dieser wachsenden Erwartungen wird eine Herausforderung für künftige Projektphasen darstellen.
Standort
Prozess
Zusammenfassung des Prozesses
Die Lösung liegt in einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Gemeinschaften und Organisationen, um die Kluft zwischen kulturellen und natürlichen Werten zu überbrücken und ganzheitliche Management-, Governance- und Erhaltungsstrategien in Welterbestätten zu fördern.
Eine verbesserte Zusammenarbeit und verstärkte internationale Partnerschaften, insbesondere für ICOMOS und IUCN (BB1), mit gemeinsamen Aufgabenbeschreibungen, gemeinsamen Vor-Ort-Besuchen und einem gemeinsamen Abschlussbericht, fördern die Interaktion zwischen Natur und Kultur auf internationaler und lokaler Ebene.
Der Einsatz verschiedener Teams (BB2), darunter ICOMOS- und IUCN-Vertreter, lokale und regionale Partner, Standortmanager und Gemeindegruppen, fördert ein Netzwerk der Zusammenarbeit und erweitert den Umfang der Diskussion.
Die gemeinsame Feldarbeit fördert die Integration verschiedener Gruppen (BB3), schafft ein ganzheitlicheres Verständnis der Stätten und unterstützt gleichzeitig die Entwicklung besserer Managementstrategien und kooperativerer Ansätze für Kultur und Natur auf allen Ebenen.
Der Kommentar zu den Schlüsselwörtern (BB4) unterstützt die gemeinsame Arbeit durch die Schaffung allgemein akzeptierter Begriffe und Konzepte. Dies trägt dazu bei, Missverständnissen entgegenzuwirken, die sich aus unterschiedlichen Bedeutungen in verschiedenen Disziplinen ergeben und einen gemeinsamen Ansatz zum Verständnis behindern.
Bauklötze
Stärkung von IUCN-ICOMOS und anderen institutionellen Partnerschaften
Connecting Practice ist das erste gemeinsam geführte Projekt von ICOMOS und IUCN im Rahmen der Welterbekonvention, das die Zusammenarbeit bei der Verknüpfung von Natur und Kultur auf institutioneller Ebene fördert, um ganzheitlichere, integrierte Ansätze für das Management und das Verständnis von Stätten zu unterstützen. Der Einsatz gemeinsamer Besuche vor Ort stellte eine deutliche Veränderung gegenüber früheren ICOMOS- und IUCN-Missionen dar und ermöglichte einen experimentelleren Ansatz zum Verständnis der Verbindung. Dazu gehörten Vor-Ort-Teams mit ICOMOS- und IUCN-Vertretern, die Erstellung gemeinsamer Aufgabenbeschreibungen, die koordinierte Planung und Organisation der Besuche vor Ort und die Erstellung eines gemeinsamen Abschlussberichts, was zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen ICOMOS und IUCN auf institutioneller und lokaler Ebene führte.
In Phase III war die FAO mit ihrem Projekt "Global Important Agricultural Heritage Systems" beteiligt. Dies führte zu einer weiteren Vernetzung und Integration der internationalen Akteure und ermöglichte die Erkundung potenzieller Synergien mit anderen internationalen Schutzgebieten durch die Betrachtung von zwei Gütern, die sowohl GIAHS als auch Welterbestätten waren. Dies führte zu einer umfassenderen Diskussion und einem fachlichen Austausch über gemeinsame Erhaltungs- und Bewirtschaftungsprioritäten und -systeme, Herausforderungen und potenziell sich gegenseitig verstärkende Antworten.
Ermöglichende Faktoren
Die Gewährleistung eines offenen Dialogs und des Informationsaustauschs zwischen allen Partnern und Mitarbeitern ist ein wesentlicher Bestandteil. Im Rahmen von Connecting Practice tragen die Beteiligung und Führung von ICOMOS und IUCN sowie das aktive Engagement von internationalen Netzwerken für Natur- und Kulturerbe in allen Aspekten des Projekts zum Dialog über das globale Erbe bei und helfen bei der Schaffung von operativen Instrumenten in professionellen Netzwerken und einzelnen Organisationen.
Gelernte Lektion
Zu den wichtigsten Lehren gehören:
1. die Erstellung gemeinsamer Aufgabenbeschreibungen und Ziele;
2. ein gemeinsamer Besuch für alle Teilnehmer (einschließlich ICOMOS- und IUCN-Vertreter, lokale Anlaufstellen, Standortmanager und andere institutionelle Partner);
3. die Erstellung eines gemeinsamen Abschlussberichts, um einen fairen, gleichberechtigten Wissensaustausch zwischen den Natur-/Kultursektoren und den lokalen und internationalen Kollegen zu gewährleisten;
4. die Sicherstellung einer ausgewogenen Mischung aus verschiedenen Fachleuten aus den Bereichen Kultur und Natur sowie Teilnehmern, die über genaue Kenntnisse des WH-Systems verfügen, einschließlich des lokalen Standortmanagements.
Die Stärkung von Netzwerken für den Dialog und die Koordinierung fördert ein nachhaltiges Umdenken und einen dauerhaften Wandel von Einstellungen und Praktiken, insbesondere in den institutionellen Bereichen von ICOMOS und IUCN.
Aufbau internationaler inter- und multidisziplinärer Teams
Der Einsatz dieser interdisziplinären und multidisziplinären Teams führt zu einem reichhaltigeren Dialog und erweitert den Umfang der Diskussion in einem Projekt wie Connecting Practice, während gleichzeitig unterschiedliche Kontexte und Ansätze für Erhaltungs- und Managementpraktiken hervorgehoben werden.
In allen Phasen von Connecting Practice wurden Anstrengungen unternommen, die Feldforschungsteams zu erweitern, um Teilnehmer mit unterschiedlichem beruflichen und Bildungshintergrund einzubeziehen, darunter Archäologen, Agronomen, Landschaftsarchitekten, Geografen, Ökologen, Anthropologen, Geologen, Natur- und Sozialwissenschaftler. In den meisten Fällen haben diese Fachleute zuvor für IUCN und ICOMOS gearbeitet oder mit ihnen zusammengearbeitet, oft mit dem Schwerpunkt Welterbe. In jeder Phase wurde mit den Verwaltern der Stätten, lokalen Denkmalschutzorganisationen und nationalen/regionalen Vertretern zusammengearbeitet und diese einbezogen.
Insbesondere in Phase III wurden größere Gruppen von Fachleuten und internationalen Partnern aus zeitgenössischen Bereichen einbezogen, um neue Facetten der Verbindung zwischen Natur und Kultur zu erforschen und Allianzen zwischen internationalen Kulturerbeprogrammen aufzubauen. Dazu gehörte auch die Einbeziehung von Fachleuten des GIAHS-Programms, nämlich eines Agraringenieurs und eines Ökologen, in die Feldforschungsteams.
Ermöglichende Faktoren
Der Erfolg dieses Bausteins hängt von der direkten und konsequenten Interaktion zwischen multidisziplinären und interdisziplinären Partnerschaften und Beziehungen ab. Dazu gehört, dass lokale Anlaufstellen und Experten direkt einbezogen werden, dass Workshops als Plattformen für Diskussionen, laufendes Feedback zu den Aktivitäten und Überlegungen zu den gewonnenen Erkenntnissen genutzt werden, dass gemeinsame Aufgabenbeschreibungen erstellt werden, um die Zusammenarbeit zu fördern, dass an der Feldarbeit und den Diskussionen während der Besuche vor Ort teilgenommen wird und dass bei der Erstellung eines gemeinsamen Abschlussberichts zusammengearbeitet wird.
Gelernte Lektion
- Die Gewährleistung eines vielfältigen Hintergrunds der Teilnehmer und Partner, einschließlich lokaler Vertreter, Standortmanager und Experten, ermöglicht eine ganzheitliche, sinnvolle Diskussion und ein besseres Verständnis des Standorts.
- Unterschiedliche Teams bieten verschiedene Ansichten und neue Perspektiven, die die Diskussionen bereichern und dazu beitragen, ein dynamischeres und ganzheitlicheres Bild einer ausgewählten Immobilie zu zeichnen.
- Workshops fördern die Zusammenarbeit, Diskussion und Interaktion. Zusätzlich zu den internationalen Connecting Practice-Workshops wurden Treffen vor Ort genutzt, um eine breitere Diskussion und vielfältigere Ergebnisse zu fördern.
- Gemeinsame Aufgabenbeschreibungen, die vor der Arbeit vor Ort entwickelt werden, schaffen einen gemeinsamen Fokus für spezifische Ergebnisse und Ziele. Das Verfassen gemeinsamer Berichte fördert die kollektive und kollaborative Diskussion unter den Teammitgliedern und ermöglicht es den Teilnehmern, unterschiedliche Ansichten zu äußern und ein gemeinsames und akzeptiertes Endprodukt zu unterstützen.
- Erkannte Synergien und Herausforderungen für ein harmonisiertes Konzept zur Erhaltung des Standorts sollten von allen Gruppen gemeinsam und gleichberechtigt genutzt und ausgetauscht werden, um kollektives Lernen zu ermöglichen.
Feldforschungen in Welterbestätten
In allen Phasen von Connecting Practice stand die Feldforschung im Mittelpunkt, mit dem Ziel, Gemeinsamkeiten zu erkennen, Verbindungen herzustellen und die Kluft zwischen Natur und Kultur zu überbrücken. In allen drei Phasen konzentrierte sich die Feldforschung auf die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Verwaltern von Stätten, Fachleuten aus dem Bereich des Kulturerbes und politischen Entscheidungsträgern vor Ort.
Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Methoden zur Durchführung von Feldbesuchen getestet. Die Besuche der Phase I hatten einen explorativen Charakter und verwendeten eine Vielzahl von Ansätzen und Arbeitsmethoden an den Stätten. Phase II konzentrierte sich auf die Schaffung einer konsistenten, gemeinsamen Struktur für die Feldarbeit, um Strategien zur Erzielung eines unmittelbaren Nutzens für die Stätten zu ermitteln. Zu den Schwerpunkten von Phase III gehörten: die Förderung biokultureller Ansätze für das Management und die Erhaltung sich ständig weiterentwickelnder Kulturlandschaften, die Übertragbarkeit von "Resilienz" in Managementmaßnahmen und die Nutzung umfassenderer Partnerschaften zur Stärkung des multidisziplinären Charakters des Projekts.
Besuche vor Ort sind entscheidend für das Verständnis der Standorte, die Herstellung von Verbindungen und die Änderung von Praktiken, wobei jede Phase Lehren und Themen für die nachfolgenden Phasen liefert. Aus den Ergebnissen der Feldarbeit lassen sich Lehren für die Entwicklung verbesserter Rahmenbedingungen und Strategien ziehen, die auf ein breiteres Spektrum von Welterbegütern und Organisationen anwendbar sind.
Ermöglichende Faktoren
Gemeinsame Missionen mit ICOMOS- und IUCN-Beteiligung, lokaler Standortverwaltung, nationalen/lokalen Vertretern und Kollegen mit unterschiedlichem Bildungs- und Berufshintergrund gewährleisten eine umfassende Untersuchung der natürlichen, kulturellen und sozialen Zusammenhänge auf Standortebene. Gemeinsame Planung und Vorbereitung, interaktive Diskussionen und Workshops vor Ort sowie die Erstellung eines gemeinsamen Abschlussberichts fördern die Integration und Beteiligung aller Teammitglieder.
Gelernte Lektion
Die Identifizierung und Auswahl geeigneter Standorte für Untersuchungen und Tests ist entscheidend. Der Standort muss einen hohen natürlichen und kulturellen Wert haben und über die Ressourcen und die Bereitschaft verfügen, ein Team für einen Besuch vor Ort zu unterstützen. Es bedarf einer sorgfältigen, detaillierten technischen und logistischen Vorbereitung vor, während und nach dem Besuch. Darüber hinaus muss diese Vorbereitung auf jeden einzelnen Standort zugeschnitten und angemessen sein.
Eine erfolgreiche Feldarbeit erfordert ein engagiertes Team, das sich darauf konzentriert, die Werte und Zusammenhänge vor Ort kennenzulernen und zu verstehen. Die Auswahl multidisziplinärer und interdisziplinärer Teammitglieder mit unterschiedlichem Berufs- und Ausbildungshintergrund sowie einem grundlegenden Verständnis des Welterbesystems ist erforderlich.
Die Klärung der Erwartungen hinsichtlich dessen, was die Feldarbeit leisten kann und was nicht, ist eine wichtige Lektion. Die Feldarbeit von Connecting Practice ist insofern experimentell, als sie Ideen, Methoden und Ansätze durch Übungen testet, aber nicht darauf ausgelegt ist, umfassende Feldforschung oder technische Unterstützung zu leisten. Es ist wichtig, dies allen Teilnehmern klar zu machen.
Erstellung eines Glossars von Begriffen
Der multidisziplinäre Ansatz von Connecting Practice mit Vertretern von Organisationen des Natur- und Kulturerbes sowie von lokalen und internationalen Partnern hat die Unterschiede in der Auslegung und im Verständnis der anwendbaren Terminologie und Konzepte deutlich gemacht. In vielen Situationen haben scheinbar ähnliche Konzepte je nach Kontext leicht unterschiedliche Bedeutungen angenommen. Die Terminologie und die Konzepte, die in einem Fachbereich verwendet werden, haben in anderen Bereichen eine andere Bedeutung, oder umgekehrt haben bestimmte Begriffe oder Konzepte in einem Bereich eine ähnliche Funktion in einem anderen Bereich. Die Anwendung mehrerer Vokabulare kann zu Verwirrung und Missverständnissen führen, die eine gemeinsame Nutzung in allen Disziplinen behindern können.
Die Schaffung einer gemeinsamen Basis für die Terminologie wurde als hilfreich für die Integration von Konzepten und Praktiken angesehen, um eine gemeinsame Nutzung und ein gemeinsames Verständnis zu gewährleisten. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, entstand als Ergebnis der Arbeit im Rahmen von Connecting Practice der Commentary on Nature-Culture Keywords. Es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung von Begriffen und Konzepten, die in drei Gruppen unterteilt sind (biokulturelle Ansätze, Resilienz und traditionelles Wissen), mit dem Ziel, ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Nutzung zu schaffen, um zukünftige Projektaktivitäten zu unterstützen.
Ermöglichende Faktoren
Dieser Baustein erforderte die Identifizierung und Beschränkung von Schlüsselwörtern auf einige wenige eindeutige Begriffe für die Forschung, die dann zu thematischen "Clustern" gruppiert wurden. Auf diese Weise ließen sich Verbindungen und Überschneidungen wirksam herausstellen. Die Untersuchung der Ursprünge und Bedeutungen der Begriffe sowie ihre Verwendung in verschiedenen Studienbereichen trugen zu einem besseren Verständnis ihrer Komplexität bei. Als "work in progress" bietet der Kommentar Flexibilität und Offenheit für Änderungen, Ergänzungen und Erweiterungen, was für seinen Erfolg wichtig ist.
Gelernte Lektion
Der Kommentar wurde mit dem Ziel erstellt, ein brauchbares Glossar mit allgemein verständlichen Begriffen und Konzepten für die zukünftige Arbeit zu schaffen. Die Herausforderung bei der Erstellung dieses Glossars war eine doppelte: Während diese Begriffe multidisziplinär sind, sich weiterentwickeln und komplexe Prozesse für das Kulturerbe weltweit beinhalten, muss das Dokument die Bedeutungsebenen und Begriffe ausreichend aufschlüsseln, um Fachleute bei konzeptionellen Aspekten der Kulturerbearbeit zu unterstützen. Der Kommentar zeigt die vielen Facetten der analysierten Begriffe und die möglichen Folgen einer uninformierten Verwendung im Bereich des Kulturerbes auf. Durch die Entwicklung einer vorläufigen Grundlage für die Bedeutung und den Ursprung dieser Begriffe zielt der Kommentar darauf ab, einen klareren Austausch zwischen den Disziplinen und Fachleuten zu schaffen. Da es sich um ein "offenes" und "vorläufiges" Dokument handelt, wird es durch zusätzliche Verweise und Terminologien bereichert und erweitert werden, wenn neue Begriffe und Konzepte erforscht werden.
Connecting Practice räumt ein, dass es Einschränkungen gibt, insbesondere in Bezug auf die Sprache, da nur englischsprachige Quellen konsultiert wurden, was die Bandbreite an Begriffen und Bedeutungen einschränkt, die andere Sprachen bieten könnten.
Auswirkungen
Umwelt: Connecting Practice betont die gemeinsamen Bemühungen um ein besseres Verständnis der Dualität von Natur und Kultur. Zu den Auswirkungen gehören die Überarbeitung des Enhancing our Heritage Toolkit, um kulturelle Welterbestätten einzubeziehen, und ein Beitrag zur Vorbereitung eines gemeinsamen Handbuchs für natürliche und kulturelle Welterbegüter. Das Projekt hat sich auf das Nominierungsverfahren ausgewirkt, insbesondere in der Phase der Vorprüfung, in der ein gemeinsames ICOMOS-IUCN-Welterbegremium vorgesehen ist.
Soziales: Das Erfahrungslernen hat sich für die Teilnehmer als wertvoll erwiesen und lieferte klare Anhaltspunkte für die künftige Arbeit, wobei die Bedeutung der zwischenmenschlichen Interaktion und gleichberechtigter, kollektiver Lernerfahrungen auf Standortebene betont wurde. Die verschiedenen Feldforschungsteams haben einen breiteren Dialog geschaffen, der von den gegenseitigen Lernerfahrungen und Praktiken profitiert. Als Ideenschmiede für neue Konzepte und Ideen hat Connecting Practice positive Auswirkungen, indem es Arbeitsmethoden und Instrumente für die künftige Nutzung durch Standortmanager direkt erprobt hat.
Wirtschaftlich: Ein häufiges Hindernis für eine wirksame Integration von Natur- und Kulturerbe ist die Trennung der institutionellen Regelungen. Die Ergebnisse des Projekts gehen über das Welterbesystem hinaus und können zur Integration von Natur- und Kulturmanagementpraktiken in Kulturerbestätten mit Mehrfachauszeichnungen beitragen.
Begünstigte
Zu den Nutznießern dieser Lösung gehören die Verwalter von Stätten, lokale Gemeinschaften, Organisationen und unabhängige Experten, die an der Verwaltung und Besichtigung von Stätten beteiligt sind, internationale Organisationen (ICOMOS, IUCN, FAO usw.) und die weltweite Welterbegemeinschaft.