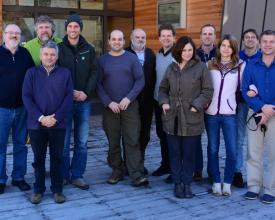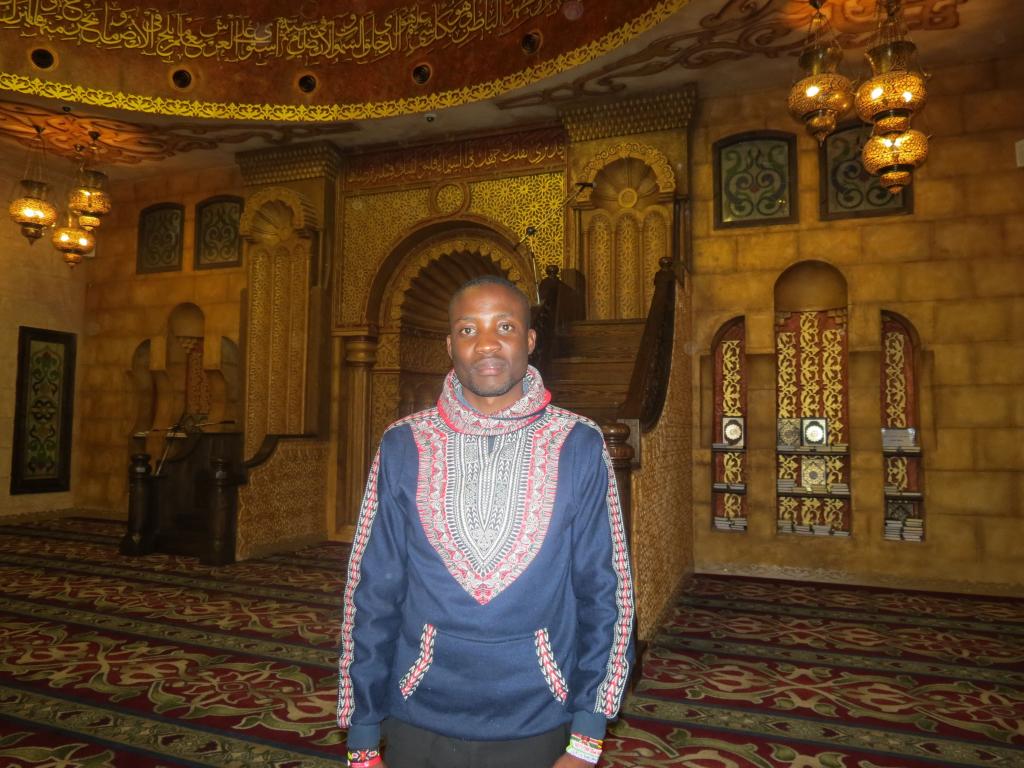Förderung der grenzüberschreitenden Koexistenz von Großraubtieren
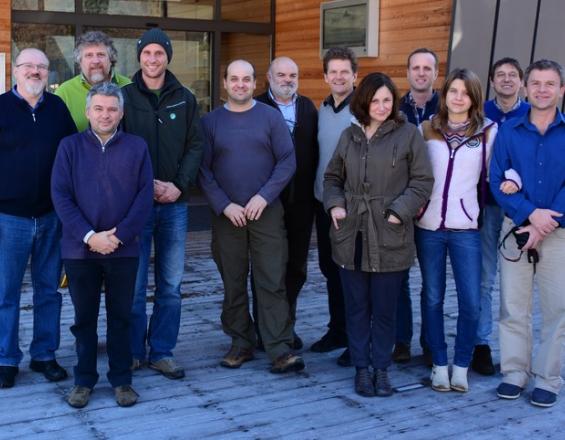
Das Projekt nutzte einen partizipativen Entscheidungsprozess, um einen grenzüberschreitenden Bärenmanagementplan für einen Naturpark in Italien (Prealpi Giulie) und einen angrenzenden Nationalpark in Slowenien (Triglav) zu entwickeln. Das Projekt führte zu einer gemeinsamen Vereinbarung über die Zuteilung von Ressourcen (Geld und Arbeitszeit) zur Befriedigung aller Interessengruppen, die sich um Braunbären in der grenzüberschreitenden Ökoregion Julische Alpen kümmern. Einige der Maßnahmen werden durch gemeinsam finanzierte Parkprojekte von 2017 bis 2026 umgesetzt.
Kontext
Angesprochene Herausforderungen
Standort
Prozess
Zusammenfassung des Prozesses
Bauklötze
Identifizierung und Formulierung des grenzüberschreitenden Entscheidungsproblems
Ermöglichende Faktoren
Gelernte Lektion
Festlegung gemeinsamer grenzüberschreitender Bewirtschaftungsziele
Ermöglichende Faktoren
Gelernte Lektion
Ressourcen
Grenzüberschreitende Managementoptionen und externe Faktoren
Ermöglichende Faktoren
Gelernte Lektion
Modellierung grenzüberschreitender Folgen und Kompromisse
Ermöglichende Faktoren
Gelernte Lektion
Bestimmung und Umsetzung der grenzüberschreitenden Ressourcenzuweisung
Ermöglichende Faktoren
Gelernte Lektion
Auswirkungen
Der gemeinsame, partizipatorische Prozess führte zu einer besseren Einbindung der Interessengruppen und ermöglichte eine häufigere Kommunikation zwischen den Behörden der beiden Schutzgebiete. Die Behörden beider Parks gelangten zu einem gemeinsamen Verständnis der gemeinsamen Ziele, Maßnahmen, externen Faktoren, die sich zumindest teilweise ihrer Kontrolle entziehen, und ihrer Zusammenhänge beim Bärenmanagement. Im Rahmen des Projekts wurde ein entscheidungsanalytisches Instrument entwickelt, das als Grundlage für ein adaptives Bärenmanagementprogramm verwendet werden kann. Die Behörden lernten auch etwas über die strukturierte Entscheidungsfindung als partizipatives Analyseverfahren, das auch in anderen Projekten angewendet werden kann. Die vereinbarten Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Tragfähigkeit der Braunbären innerhalb und außerhalb des TB-Gebiets um mehr als 50 % zu erhöhen, eine nachhaltige Landwirtschaft durch die Beibehaltung kleiner Betriebe zu erhalten und Konflikte zwischen den Interessengruppen zu minimieren. Während des Projekts setzten sich die slowenischen Parkbehörden erfolgreich für eine Gesetzesänderung ein, die die administrativen Hürden für die Entnahme von Bären aus der freien Wildbahn nach Störungen auf Privatgrundstücken verringert. Die Verringerung dieses Verwaltungsaufwands wird die öffentliche Wahrnehmung des Schutzgebietsmanagements für Braunbären in der TB-Region verbessern.
Begünstigte
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Geschichte