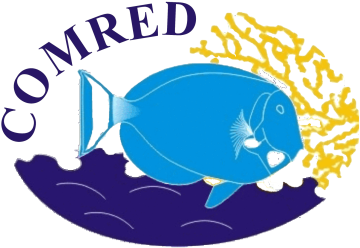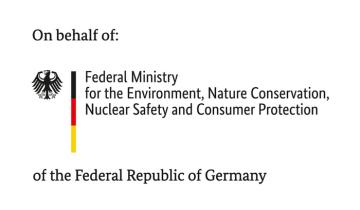Geschlechtergerechte Imkerei zum Schutz der Mangroven und zur Sicherung des Lebensunterhalts in Kwale und Tanga

Das von IKI-BMUKN finanzierte Projekt Grenzüberschreitende Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung der Küsten- und Meeresbiodiversität in Kwale, Kenia und Tanga, Tansania , unterstützt die Erhaltung der Meeres- und Küstenbiodiversität durch gemeinschaftsbasierte und geschlechtsspezifische Ansätze. Um den Druck auf die Mangroven-Ökosysteme zu verringern, wurde im Rahmen des Projekts die nachhaltige Imkerei als alternative Lebensgrundlage für lokale Gemeinschaften in Kwale und Tanga eingeführt. Die Mentorenschulung besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil konzentriert sich auf den Bau von Bienenstöcken, die Verwaltung der Bienenvölker und die Honigproduktion. Der zweite Teil findet statt, wenn der Honig erntereif ist, und vermittelt Kenntnisse über die Verarbeitung und Wertschöpfung, einschließlich der Verwendung von Bienenwachs zur Herstellung von Produkten wie Kerzen und Salben. Durch Mentoring und ein integratives Schulungskonzept werden Frauen, die zuvor aufgrund kultureller Tabus ausgeschlossen waren, nun zu aktiven Teilnehmerinnen an der Bienenzucht. Das Projekt unterstützt sowohl den Umweltschutz als auch die lokale Einkommensbildung.
Kontext
Angesprochene Herausforderungen
- Verschlechterung des Mangrovenlebensraumes
Die Mangroven-Ökosysteme in den Bezirken Kwale (Kenia) und Mkinga (Tansania) sind durch die nicht nachhaltige Ausbeutung für Holz- und Nichtholzprodukte, die Umstellung auf Landwirtschaft und Aquakultur sowie durch Verschmutzung stark gefährdet. - Geringe Honigproduktion und mangelhafte Qualität
Die Produktion ist aufgrund begrenzter Imkerfähigkeiten, minderwertiger Bienenstöcke und Ausrüstung sowie schlechter Erntetechniken gering, was zu einer schlechten Honigqualität führt. Den Honig-Wertschöpfungsketten in Kwale und Mkinga fehlt es an strukturierten Marktverbindungen und wertsteigernden Aktivitäten, was das Einkommenspotenzial der Gemeinden einschränkt. - Begrenzte technische Kapazitäten
Lokale Imker, Beratungspersonal und Schreiner verfügen über unzureichende Fähigkeiten und sind nicht ausreichend geschult, was sich erheblich auf die Belegung der Bienenstöcke und die Honigproduktion auswirkt. - Geschlechtsspezifischer Ausschluss von Frauen von der Imkerei: Seit Generationen wird die Imkerei in Kenias Küstengemeinden als eine von Männern dominierte Praxis angesehen, die tief in traditionellen und religiösen Normen verwurzelt ist. Dies verwehrt Frauen den Zugang zu den wirtschaftlichen und sozialen Vorteilen der Honigerzeugung.
Standort
Prozess
Zusammenfassung des Prozesses
Die vier Bausteine sind so konzipiert, dass sie als integrierter Prozess funktionieren, der eine nachhaltige, von den Gemeinden betriebene Imkerei unterstützt. Die anfängliche Analyse der Wertschöpfungskette (Baustein 1) bildete die Grundlage, indem sie Wissenslücken, Ausrüstungsmängel und Möglichkeiten für gezielte Maßnahmen aufzeigte. Dies bildete die Grundlage für die Entwicklung der Schreinerschulung (Baustein 2), mit der der Mangel an hochwertigen Bienenstöcken behoben und eine lokale Produktion mit verbesserten Designs ermöglicht wurde. Da nun qualitativ hochwertige Bienenstöcke vor Ort verfügbar waren, führte das Projekt eine erste Phase des Kapazitätsaufbaus durch (Baustein 3), in der ausgewählte Gemeindemitglieder und Regierungsbeamte mit praktischen und theoretischen Fähigkeiten ausgestattet wurden, um die Bienenstöcke effektiv zu verwalten und ihr Wissen im Rahmen eines Modells für die Ausbildung von Ausbildern weiterzugeben. Sobald die Honigproduktion angelaufen war, wurde in der zweiten Schulungsphase (Baustein 4) eine praktische Unterweisung in Wertschöpfung und Produktentwicklung durchgeführt, die die Teilnehmer in die Lage versetzte, Bienenstockprodukte unter Verwendung lokaler Materialien zu verarbeiten und zu vermarkten. Zusammen bilden die Blöcke einen schrittweisen Ansatz, der von der Diagnose über den Aufbau von Kapazitäten bis hin zur Produktentwicklung reicht und sowohl die ökologischen als auch die wirtschaftlichen Ergebnisse verbessert.
Bauklötze
Analyse der Wertschöpfungskette von Mangrovenhonig
Im Rahmen des Projekts wurde eine eingehende Analyse der Wertschöpfungskette für Mangrovenhonig in Kwale (Kenia) und Mkinga (Tansania) durchgeführt, um strategische Maßnahmen zur Unterstützung des Naturschutzes und der lokalen Lebensgrundlagen zu entwickeln. Mithilfe der ValueLinks-Methode wurden die Akteure und Ströme in der Kette erfasst, darunter Imker, Lieferanten von Betriebsmitteln, Schreinereien, Beratungsdienste, Händler und Verbraucher. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehörten minderwertige Bienenstockausrüstungen, geringe Produktion, fehlende Ausbildung und schwache Marktverbindungen. Der meiste Honig wird lokal mit minimaler Wertschöpfung verkauft. Die Analyse ergab, dass Mangrovenhonig als ökologisches Nischenprodukt vermarktet werden könnte. Zu den Empfehlungen gehörten die Ausbildung von Imkern und Zimmerleuten, die Förderung des individuellen Besitzes von Bienenstöcken, die Einrichtung von Honigsammelstellen und die Verbesserung des Marktzugangs. Diese Analyse stellte sicher, dass die Projektmaßnahmen direkt auf die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt waren, und bildete die Grundlage für den anschließenden Aufbau von Kapazitäten und die Vermarktung.
Ermöglichende Faktoren
Die Präsenz aktiver technischer Partner wie WWF, WCS, IUCN, CORDIO und Mwambao schuf ein starkes Unterstützungsnetz, das der Analyse zugute kam. Lokale Schreiner und Lieferanten von Betriebsmitteln in Kwale und Tanga produzierten bereits Bienenstöcke und schufen so eine praktische Anlaufstelle. Imker und Regierungsbeamte lieferten bei Feldbesuchen und Interviews Produktionsdaten und offene Einblicke, und die Anwendung der ValueLinks-Methodik half bei der Strukturierung des Kartierungsprozesses.
- Beteiligung und Beiträge von wichtigen Interessengruppen, einschließlich Imkern, Regierungsbeamten und NROs.
- Vorhandene Daten und lokales Wissen aus früheren Bienenzuchtinitiativen.
- Klare Methodik (standardisierte Fragebögen, halbstrukturierte Interviews, Feldbeobachtungen), die eine konsistente und überprüfbare Datenerhebung gewährleistet.
Gelernte Lektion
Die Durchführung einer Wertschöpfungskettenanalyse zu Beginn des Projekts half dabei, die Maßnahmen an den tatsächlichen Bedürfnissen auszurichten. Die Probleme der Imker, wie schlechte Bienenstockqualität, geringe Produktion und unzureichende Ausbildung, konnten mit gezielter Unterstützung angegangen werden. Gruppenimkereien waren oft ineffektiv, so dass die Förderung der Eigenverantwortung die Ergebnisse verbesserte. Die Nachfrage nach Mangrovenhonig bietet die Möglichkeit zur Markenbildung und Einkommensgenerierung, erfordert jedoch Investitionen in Qualitätskontrolle und Aggregation. Die Kartierung der Wertschöpfungskette zeigte auch Lücken in der Wertschöpfung auf und unterstrich die Bedeutung von Schulungen und Mentoring, insbesondere durch einen Ansatz zur Ausbildung von Ausbildern.
Zimmermannsausbildung für verbesserte Bienenstöcke
Sowohl in Kwale (Kenia) als auch in Mkinga (Tansania) waren die vor Ort hergestellten Bienenstöcke oft minderwertig und trugen zu einer schlechten Belegung der Bienenvölker und geringen Honigerträgen bei. Das Projekt reagierte darauf, indem es Tischlerwerkstätten ausfindig machte und ausgewählte Tischler in der Herstellung von verbesserten Kenya Top Bar Hives (KTBH) und anderen standardisierten Modellen ausbildete. In Kwale wurden zwei Werkstätten (Lunga Lunga und Tiwi) ins Visier genommen, wobei Lunga Lunga bereits Bienenstöcke in großem Maßstab herstellt, die jedoch technisch verbessert werden müssen. In Mkinga fand die Schulung in Tanga City statt. Der Schwerpunkt der Schulung lag auf den korrekten Abmessungen der Bienenstöcke, den geeigneten Materialien und den Grundlagen der Bienenbiologie, um sicherzustellen, dass die Zimmerleute die Funktionalität der einzelnen Konstruktionsmerkmale verstanden. Nach der Schulung produzierten die Werkstätten weiterhin Bienenstöcke, um die lokale Nachfrage zu befriedigen, so dass die Gemeindemitglieder die Bienenstöcke kaufen konnten, anstatt auf Spenden angewiesen zu sein. Dies trug zum Aufbau lokaler Eigenverantwortung bei und unterstützte ein nachhaltiges Modell für die Versorgung mit Bienenstöcken, das über das Projekt hinaus weitergeführt werden kann. Diese Maßnahme legte auch den Grundstein für weitere Unterstützung für Imker, die nun Zugang zu besserer Ausrüstung in ihrer Region haben.
Ermöglichende Faktoren
Bestehende Schreinereien in Kwale und Tanga hatten Erfahrung mit der Bienenstockproduktion und waren bereit, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Die lokale Nachfrage nach Bienenstöcken stieg, da die Imkerausbildung ausgebaut werden sollte. Das Projekt hatte Zugang zu technischen Experten, die die Ausbildung leiten konnten, und die Beiträge von Imkereibeamten und erfahrenen Imkern sorgten für Praxisnähe. Die Ausbildung profitierte auch von einer eindeutigen Marktlücke: Standardbeuten waren vor dieser Maßnahme nicht verfügbar oder unerschwinglich.
- Qualifizierte lokale Schreiner in der Gemeinde verfügbar.
- Verfügbarkeit geeigneter lokaler Materialien für den Bau von Bienenstöcken.
- Klare Richtlinien und Standardspezifikationen, die von den Ausbildern bereitgestellt wurden und direkt mit der Bienenbiologie verbunden waren.
Gelernte Lektion
Die örtlichen Schreiner waren bereit, sich zu beteiligen und konnten große Mengen an Aufträgen annehmen, aber ohne spezielle Schulung fehlte ihnen das Verständnis für die wichtigsten Konstruktionsmerkmale. Die Schulungsinhalte müssen über die Holzbearbeitung hinausgehen und die Bienenbiologie einbeziehen, um die Funktionalität der Bienenstöcke und eine einfache Inspektion zu gewährleisten. Eine mangelhafte Bienenstockproduktion führt zu einer schlechten Auslastung und einem geringeren Vertrauen in die Imkerei als Lebensgrundlage. Die kontinuierliche Qualitätskontrolle bleibt eine Herausforderung und sollte durch Nachbetreuung angegangen werden. Das Modell funktioniert am besten, wenn die Zimmerleute in die lokalen Märkte eingebunden sind und direkt mit den Imkern zusammenarbeiten. Durch die Ausbildung von Zimmerleuten wird die lokale Wirtschaft von spendenbasierten Modellen auf gemeinschaftsbasiertes Unternehmertum umgestellt. Ein gemeinsames Verständnis zwischen Imkern, Beratungsfachleuten und Zimmerern hilft, Fehlentwicklungen bei der Gestaltung von Bienenstöcken und der Bewirtschaftung zu vermeiden. Der Erfolg dieses Ansatzes zeigt, dass die Unterstützung vorgelagerter Akteure in der Wertschöpfungskette die Ergebnisse für die Endverbraucher verbessern kann.
Ausbildung von Ausbildern für nachhaltige Imkereipraktiken
Sowohl in Kwale als auch in Mkinga verfügten die Imker nur über begrenzte Kenntnisse über ein verbessertes Bienenstockmanagement und kämpften mit geringen Erträgen, schlechter Handhabung der Ausrüstung und mangelndem Vertrauen in grundlegende Imkereipraktiken. Um diese Lücke zu schließen, wurde im Rahmen des Projekts ein umfassendes Programm zur Schulung von Ausbildern für nachhaltige Imkereipraktiken durchgeführt. Zu den Teilnehmern gehörten ausgewählte Imker, Frauen und Jugendliche sowie Beamte der Viehwirtschaft. Die Schulung konzentrierte sich auf Schlüsselthemen wie Bienenbiologie und -ökologie, Auswahl von Bienenstandorten, Verwaltung und Vermehrung von Bienenvölkern, Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, Bestäubungsdienste, Imkerausrüstung, Buchführung und die Auswirkungen von Pestiziden auf Bienen. Auch Bienenstockprodukte und die aktuelle Forschung in diesem Sektor wurden behandelt. Der Schwerpunkt lag auf praktischem Lernen, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer ihr Wissen sofort und selbstbewusst anwenden konnten. Durch die Einbeziehung von Beratungsbeamten wurde die institutionelle Kapazität zur Unterstützung der Imker über das Projekt hinaus verbessert. Von den geschulten Personen wurde erwartet, dass sie ihr Wissen weitergeben und andere in ihren Gemeinden anleiten, was zu einer breiteren Akzeptanz verbesserter Praktiken und zur langfristigen Nachhaltigkeit der Bienenzucht als naturbasierte Lebensgrundlage in Mangrovengebieten beiträgt.
Ermöglichende Faktoren
- Aktive Beteiligung und Unterstützung durch die lokale Regierung und gemeindebasierte Gruppen. Die Einbeziehung von Viehzüchtern stärkte die institutionelle Verantwortung, und das Vorhandensein von reichlich Futter und Wasser machte technische Verbesserungen unmittelbar wirksam.
- Verfügbarkeit geeigneter Bienenstöcke für praktische Demonstrationen. Praktischer Schulungsansatz war entscheidend
- Verwendung von zugänglichem Schulungsmaterial und Erklärungen in der Landessprache zur Verbesserung des Verständnisses.
Gelernte Lektion
Ohne praktische Schulung hatten viele Gruppen Probleme mit der grundlegenden Bienenstockverwaltung, den Erntetechniken und dem Erkennen von reifem Honig. Dies führte zu geringen Erträgen, dem Abwandern von Bienenvölkern und sogar zum Verderben des geernteten Honigs. Das ToT-Modell ermöglichte den Austausch von lokalem Wissen, aber eine anschließende Betreuung ist entscheidend, um das Gelernte zu festigen und Kompetenzlücken zu vermeiden. Die Einbeziehung von Regierungsbeamten in die Schulung erwies sich als vorteilhaft, da sie dazu beitrug, die Kluft zwischen Erzeugern und Unterstützungsdiensten zu überbrücken. In einigen Fällen fehlte es den Viehzüchtern an Vorführgeräten und sie waren nicht in der Bienenhaltung geschult worden, was ihre Möglichkeiten zur Unterstützung der Gemeinden einschränkte. Die Schulungen müssen auch praktische Übungen mit echten Bienenstöcken umfassen, nicht nur Demonstrationen. Künftig sollten ToTs immer Auffrischungskurse und Unterstützung erhalten, um in ihren Gemeinden fortlaufend Peer-Unterstützung zu leisten.
Wertschöpfung durch die Herstellung bienenbasierter Produkte unter Verwendung lokal verfügbarer Materialien
Die zweite Phase der Imkerschulung, die in Kwale durchgeführt wurde, konzentrierte sich auf die Nacherntebehandlung und die Wertschöpfung von Bienenstockprodukten. Sie war als Folgeaktivität der Ausbildung von Ausbildern (Training of Trainers - TOT) konzipiert, um die in der ersten Phase erworbenen technischen Fähigkeiten zu ergänzen. Zu den Teilnehmern gehörten Imkerei-Totalausbilder und ausgewählte Gruppenmitglieder, die Honig aus ihren Bienenstöcken geerntet hatten. Die Schulung umfasste richtige Erntetechniken, Hygiene und Methoden zur Verarbeitung von Rohhonig und Bienenstocknebenprodukten wie Bienenwachs und Propolis. In praktischen Übungen konnten die Teilnehmer eine Reihe von marktfähigen Produkten herstellen, darunter Bienenwachskerzen, Körpercreme, Lippenbalsam, Lotionstangen, Brandsalbe und Hustensirup. Für die Verpackung und das Produktdesign wurden lokal verfügbare Materialien wie Kokosnussschalen, Bambus und recyceltes Glas verwendet. Der Schwerpunkt der Schulung lag auf Produktqualität, Haltbarkeit und Markenbildung, um die Marktfähigkeit zu verbessern. Diese Phase förderte auch die Innovation und den gegenseitigen Austausch, da die Teilnehmer Ideen für die Verwendung von Bienenprodukten in der traditionellen Medizin oder der Körperpflege austauschten. Die Wertschöpfungskomponente stärkt das Einkommenspotenzial der Imker und unterstützt das übergeordnete Ziel, nachhaltige, mangrovenverträgliche Lebensgrundlagen zu schaffen.
Ermöglichende Faktoren
Die Teilnehmer hatten bereits in der ersten Schulungsphase praktische Erfahrungen gesammelt und waren motiviert, ihr Wissen zu erweitern. Die Verfügbarkeit von geerntetem Honig aus früher aufgestellten Bienenstöcken ermöglichte eine sofortige praktische Anwendung. Die Ausbilder brachten Erfahrung in der Produktformulierung und -verpackung unter Verwendung lokaler Materialien mit. Die Unterstützung durch lokale Organisationen und Sammelstellen schuf Wege für den künftigen Verkauf. Das Interesse der Gemeinschaft an Naturprodukten trug dazu bei, die Wertschöpfung als rentable Einkommensquelle zu positionieren.
Gelernte Lektion
Viele Teilnehmer hatten keine Vorkenntnisse über die Verarbeitung von Bienenstockprodukten und schätzten den praktischen Ansatz. Die Demonstration von Mehrwert-Produktoptionen steigerte das Vertrauen und die Motivation, insbesondere bei den weiblichen Teilnehmern. Die Verwendung vertrauter, lokal beschaffter Materialien für die Verpackung trug zur Kostensenkung bei und erhöhte die Relevanz für die ländlichen Erzeuger. Das im Training of Trainers-Ansatz hervorgehobene Peer-Learning erwies sich als effektiv, da einige Teilnehmer damit begannen, andere bei der Wertschöpfung zu beraten, noch bevor formale Aggregationsmodelle vorhanden waren. Es reicht nicht aus, die Teilnehmer nur einmal zu schulen; Auffrischungssitzungen und fortlaufende Unterstützung sind unerlässlich, um die Produktqualität und die Marktreife zu verbessern. Insgesamt förderte die Verknüpfung von Produktion und Wertschöpfung eine stärkere Eigenverantwortung der Bienenstöcke und ein langfristiges Engagement für die Imkerei.
Auswirkungen
Sozioökonomisch:
- Vermehrte Besiedlung bestehender Bienenstöcke sowie vermehrte Anzahl neuer Bienenstöcke
- Die Honigerträge haben sich in mehreren Imkergruppen verbessert. Die Tunusuru-Gruppe zum Beispiel steigerte den Ertrag von 14 kg unreifem und fermentiertem Honig auf 25 kg reifen Honig aus nur 2 Bienenstöcken und erreichte damit 12,5 kg pro Bienenstock, was über dem Durchschnittsertrag von 10 kg pro Bienenstock liegt.
- 21 Frauen wurden in der Verwaltung der Bienenstöcke und der Wertschöpfung geschult, was zum Haushaltseinkommen beiträgt und die Wahrnehmung der Gemeinschaft verändert.
- Sieben verschiedene Produkte auf Bienenbasis werden vor Ort hergestellt, darunter Bienenwachskerzen, Lippenbalsam und Körpercreme
Begünstigte
- Lokale Imkergruppen und Gemeindemitglieder in Kwale County, Kenia, und Mkinga District, Tansania
- Frauen und Jugendliche, die nur begrenzten Zugang zu einkommensschaffenden Maßnahmen hatten
- Lokale Zimmerleute bei der Ausbildung zum Bau von Bienenstöcken
Globaler Rahmen für die biologische Vielfalt (GBF)
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Geschichte

Das Summen des Wandels: Bienenzucht und die Frauen von Yungi
Die Flut zieht sich zurück und gibt einen schmalen Pfad durch den glitzernden Sand frei, die einzige Möglichkeit, Yungi zu Fuß zu erreichen, bevor das Meer seinen Weg zurückerobert. Hier, auf dieser ruhigen Insel vor Kenias Südküste, scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Wenn die Morgendämmerung anbricht, erwacht Yungi zum Leben - nicht durch die Geräusche von Verkehr oder Maschinen, sondern durch die Melodie der Natur. Vögel rufen aus dem uralten Kaya-Wald, ihr Gesang vermischt sich mit dem stetigen Summen der Bienen, die durch das dichte Dickicht fliegen und Nektar von wilden Blüten sammeln. Hier spricht das Land, und wer lange genug hier gelebt hat, hat gelernt zuzuhören.
An der einzigen Wasserstelle in Yungi treffen wir Khadijah und ihre Freundinnen, die Wasser für den kommenden Bienenstock holen. Sie hat beobachtet, wie sich dieses Land verändert hat, wie sich die Menschen hier wie die Gezeiten verändern. Ihre Kinder sind hier aufgewachsen, ihre kleinen Füße sind auf denselben schmalen Wegen zur Schule gegangen, vorbei am Mangrovenbestand in Majoreni.
Ihr Vater führte sie als Kind in die Bienenzucht ein. Sie erinnert sich daran, wie er in den Mangroven und im nahe gelegenen Wald verschwand, um nach seinen vier Bienenstöcken zu sehen, und mit goldenem Honig zurückkehrte, den er sorgfältig lagerte, um auf einen Käufer zu warten, der vielleicht erst nach Wochen oder gar Monaten kam. Die Abgeschiedenheit der Insel machte alles langsam: Geld, Handel und Fortschritt. Sie führte seine Arbeit fort, indem sie aus seinen alten Bienenstöcken sechs machte, indem sie zwei eigene Bienenstöcke hinzufügte und dann fünf Langstroth-Bienenstöcke von COMRED erhielt.
Bei jeder Ernte füllte sie ihre 20-Liter-Kanister mit Honig und wartete geduldig auf einen Käufer. Jahrelang verkaufte sie ihren Honig für nur 250 KSh pro Kilogramm und kannte nie seinen wahren Wert. Um ihre Familie zu ernähren, betrieb sie neben der Imkerei eine Landwirtschaft, da sie als älteste Tochter keine andere Wahl hatte. Die Bienenzucht war ein Erbe, aber das Überleben war eine Pflicht. Erst als sie eine Imkerschulung besuchte, erfuhr sie die Wahrheit: Ihr Honig konnte, richtig verarbeitet, für bis zu 1.000 KSh pro Kilogramm verkauft werden . Die Erkenntnis traf sie wie eine Welle an der Küste. Honig war nicht nur eine Tradition, er war eine Lebensader, eine Brücke zu etwas Größerem.
Und jetzt baut sie diese Brücke. Dieser Satz stammt aus ihrer Ausbildung, aber in ihrer Welt bedeutet er mehr. Es geht darum, Herausforderungen zu meistern, ihr Volk anzuführen und dafür zu sorgen, dass niemand zurückgelassen wird. Als Matriarchin geht sie voraus, und die anderen folgen ihr.
Die Frauen von Yungi werden vor nichts Halt machen, bis ihre Bienenstöcke voll sind und ihre Gemeinschaft gedeiht!
(Quelle: COMRED)