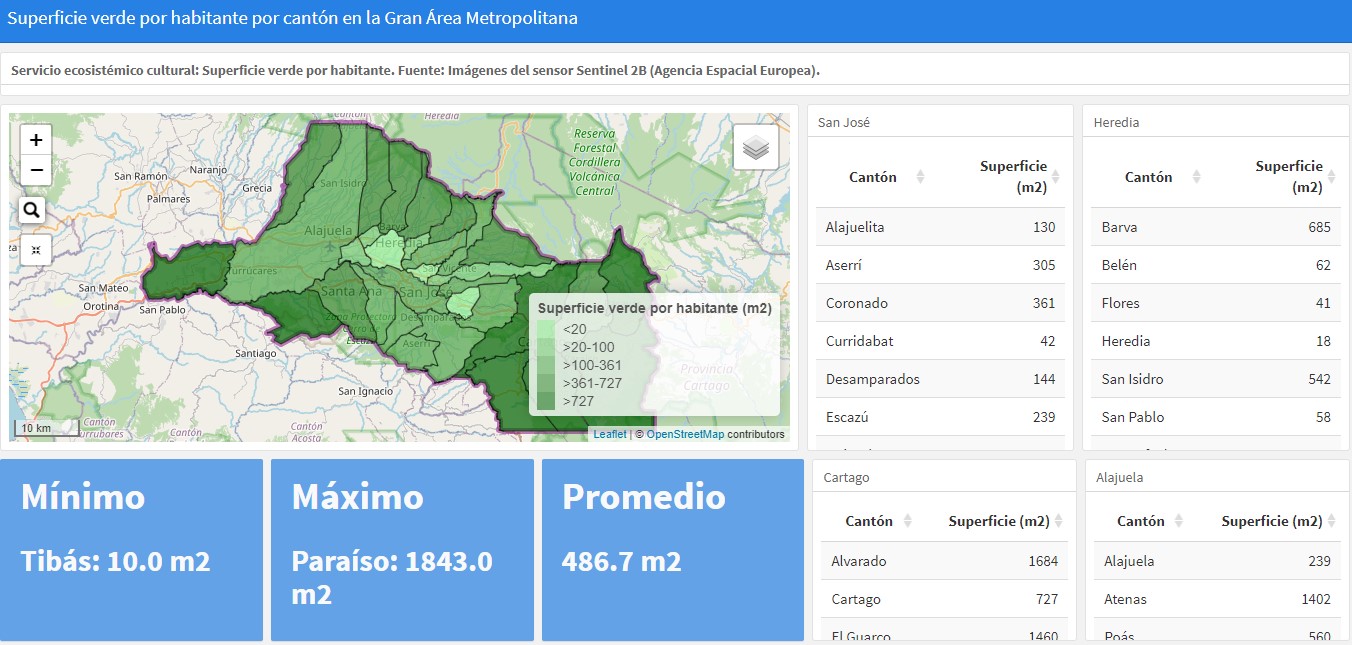Jedes Jahr nimmt Save The Waves ein neues World Surfing Reserve aus Surfergemeinden in aller Welt auf. Das Bewerbungsverfahren erfordert einen erheblichen Arbeitsaufwand für die lokalen Gemeinschaften, und ihre Anfrage basiert auf den folgenden Kernkriterien:
1) Qualität und Beständigkeit der Welle(n);
2) Wichtige Umweltmerkmale;
3) Kultur und Surfgeschichte;
4) Verwaltungskapazität und lokale Unterstützung;
5) Vorrangiges Schutzgebiet
Jede Bewerbung wird von einem unabhängigen Vision Council geprüft, der sich aus Fachleuten aus den Bereichen Naturschutz, Wirtschaft, Gemeinnützigkeit und Surfen zusammensetzt. Sobald das World Surfing Reserve auf der Grundlage der strengen Kriterien ausgewählt wurde, durchläuft es den Stewardship Planning Process und die anderen Bausteine, um das World Surfing Reserve formell einzuweihen.