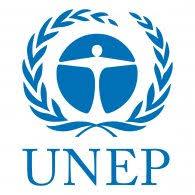Anwendung der ökosystembasierten Katastrophenvorsorge (Eco-DRR) im integrierten Wasserressourcenmanagement (IWRM) im Lukaya-Becken, DRC

Das Projekt zielte auf die Verringerung des Katastrophen- und Klimarisikos als integralen Bestandteil eines Prozesses des integrierten Wasserressourcenmanagements (IWRM) ab, der in der Demokratischen Republik Kongo gleichzeitig stattfindet. Ökosystembasierte Pilotmaßnahmen zielten darauf ab, die Boden- und Gullyerosion sowie das Überschwemmungsrisiko an zwei Standorten (flussaufwärts und flussabwärts) im Lukaya-Becken zu verringern und gleichzeitig die Lebensgrundlagen und Einkommen zu verbessern. Auf lokaler und nationaler Ebene wurden Kapazitäten für ökosystembasierte Maßnahmen aufgebaut und die nationale Interessenvertretung für EbA/Eco-DRR wurde durch IWRM unterstützt.
Das Projekt verfolgte einen Öko-DRR-Ansatz, der sich mit Gefahren und Anfälligkeit befasst, um das Katastrophenrisiko zu verringern. Die Projektaktivitäten zielten jedoch auch auf die Anpassung an den Klimawandel ab, indem sie sich mit den Auswirkungen des Klimawandels und der Anfälligkeit der Menschen für Veränderungen durch die ökosystembasierten Maßnahmen des IWRM befassten. Somit können diese Maßnahmen sowohl als Öko-DRR als auch als EbA betrachtet werden, während der Umsetzungsrahmen Öko-DRR war.
Kontext
Angesprochene Herausforderungen
Die Bewirtschaftung der Wasserressourcen ist eine Herausforderung, die zum Teil auf die ungeplante und unkoordinierte Landnutzung zurückzuführen ist. Die rasche Verstädterung, die Brandrodung, der Abbau von Steinbrüchen, die Holzkohleproduktion und der Gartenbau haben zur Abholzung der Wälder und zur Verschlechterung der Land- und Flusswasserqualität geführt. Die übermäßige Erosion hat zu Abflussrinnen und Erdrutschen geführt und das Überschwemmungsrisiko erhöht, was aufgrund der zunehmenden Regenfälle zu einem großen Problem geworden ist und auch die Sedimentverschmutzung im Wasser erhöht.
Standort
Prozess
Zusammenfassung des Prozesses
Die Einbeziehung von Eco-DRR/EbA in die Entwicklung eines IWRM-Aktionsplans (Baustein 1) ist das grundlegende Ziel des Projekts. Feldaktivitäten wie Agroforstwirtschaft und Wiederaufforstung (Baustein 2) sowie der Schutz vor Gullys und Bodenerosion (Baustein 3) dienen der Demonstration ökosystembasierter Maßnahmen und ihrer Vorteile für die Einbeziehung in (Baustein 1). Der Aufbau von Kapazitäten (Baustein 4) und die nationale Interessenvertretung (Baustein 5) unterstützen die langfristige Nachhaltigkeit des IWRM und der ökosystembasierten Maßnahmen zur Verringerung des Katastrophenrisikos und zur Anpassung an den Klimawandel.
Bauklötze
Einbeziehung von Eco-DRR/EbA in die Entwicklung eines IWRM-Aktionsplans
Um einen risikobasierten und nachhaltigen Rahmen für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen im Lukaya-Einzugsgebiet zu schaffen, werden ökosystembasierte Maßnahmen in einen Aktionsplan für integriertes Wasserressourcenmanagement (IWRM) einbezogen. Die Vereinigung der Nutzer des Lukaya-Einzugsgebiets (AUBR/L) hat den Plan mit Unterstützung des UNEP und eines internationalen Experten entwickelt und ist für seine Umsetzung verantwortlich.
Der Plan umreißt eine Reihe vorrangiger Maßnahmen, die sich auf vier Säulen stützen: Wasser, Umwelt, Landnutzungsplanung und Governance. Ein integraler Bestandteil des Aktionsplans ist die Förderung nachhaltiger Ökosystemmanagementansätze innerhalb des übergeordneten Rahmens des IWRM.
Bei der Entwicklung des IWRM-Aktionsplans wurde betont, wie wichtig es ist, die flussaufwärts und flussabwärts gelegenen Gemeinden zu vernetzen und ihr Wissen über die geografischen und sozioökonomischen Bedingungen in ihrem gemeinsamen Flusseinzugsgebiet zu verbessern. Mit Hilfe einer partizipatorischen 3D-Kartierung wurden Gefahren, Landnutzungsarten und natürliche Ressourcen kartiert und die wichtigsten Umweltprobleme und gefährdeten Gebiete im Einzugsgebiet durch einen partizipatorischen Ansatz unter Beteiligung mehrerer Interessengruppen ermittelt.
Darüber hinaus wurden Bodenerosions- und hydrometeorologische Überwachungssysteme eingerichtet, um eine Modellierung des Hochwasserrisikos zu ermöglichen. Auf diese Weise werden Grundlinien festgelegt und Daten für die IWRM-Planung bereitgestellt.
Ermöglichende Faktoren
Das Eco-DRR-Projekt wurde in Verbindung mit einem von der UNDA finanzierten IWRM-Projekt in demselben Gebiet durchgeführt.
Die partizipative 3D-Kartierung ist ein hervorragendes Instrument, weil sie die Integration von lokalem
durch die Beteiligung vieler Interessengruppen und den Einsatz von geografischen Informationssystemen die Integration von lokalem Raumwissen mit topografischen Daten.
Ein Schlüsselelement für die erfolgreiche Förderung von Öko-DRR durch IWRM in der DRK war die nachhaltige Beteiligung der lokalen Flussnutzer durch die AUBR/L.
Gelernte Lektion
Der Prozess der IWRM-Planung war intensiv und es dauerte fast ein Jahr, bis der erste Entwurf erstellt war.
Der gemeinschaftsbasierte Ansatz (durch AUBR/L) ist geeignet, da die zentrale technische Verwaltung auf lokaler Ebene in der DRK nach dem Konflikt nur schwach vertreten ist. Die Tatsache, dass es eine bestehende Wasserwirtschaftsinstitution gibt, war ein Glücksfall und ermöglichte es, wichtige Interessengruppen aus dem flussaufwärts und flussabwärts gelegenen Gebiet zusammenzubringen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Für die Entwicklung des Plans und auch für Aktivitäten wie die Installation von Überwachungssystemen auf dem Land war es entscheidend, die Zustimmung der Betroffenen zu erhalten.
Für den Prozess wurden mehrere Multi-Stakeholder-Workshops und Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt. So konnten die Teilnehmer das Einzugsgebiet als gemeinsame Landschaft begreifen und gemeinsame Prioritäten für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Einzugsgebiets festlegen, die auch zur Klima- und Katastrophenresilienz beiträgt.
Agroforstwirtschaft und Wiederaufforstung
Aufforstung und Begrünung wurden an geschädigten Hängen und um eine Wasseraufbereitungsanlage herum durchgeführt, um Erosion und Überschwemmungsgefahr zu verringern. Um Setzlinge für die Wiederaufforstung und die Agroforstwirtschaft bereitzustellen, wurden kommunale Baumschulen eingerichtet.
Auf 15 ha wurde eine gemeinschaftsbasierte Agroforstwirtschaft eingerichtet, um 20 Haushalten eine zusätzliche Existenzgrundlage zu bieten. Sie basiert auf einem achtjährigen Rotationszyklus von Pflanzenbau und Forstwirtschaft (auf acht Parzellen, von denen jedes Jahr eine hinzukommt), der eine nachhaltige Bewirtschaftung des Landes und die Verringerung der Bodenerosion ermöglicht. Auf einer Parzelle werden drei Arten von Pflanzen angebaut, nämlich Akazien, Maniok und Kuhbohnen, die sich gegenseitig verstärken. Auch Imkerei wird betrieben. Der Ertrag aus all dem erhöht jährlich das Einkommen aller Haushalte, die es gemeinsam bewirtschaften. Die Haushalte, der Landeigentümer und die Vereinigung haben eine Vereinbarung getroffen, wonach 50 % der Erträge an die Bauern, 25 % an die Vereinigung und 25 % an den Landeigentümer gehen.
Erwartetes Einkommen aus 1 ha, Jahr 1: 3.000 USD aus der Produktion von 100 Säcken Holzkohle aus Stümpfen + 6.250 USD aus der Ernte von 2.500 kg Kuhbohnen; Jahr 2: 9.615 USD aus 6.410 kg Maniok; Jahr 3-7: 7.000 USD aus 1.000 l Honig; Jahr 8: 35.000 USD aus 1.750 Säcken Holzkohle, die aus reifen Akazienbäumen hergestellt wurden.
Ermöglichende Faktoren
Die Bewertungsmethode "Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs" (InVest) wurde verwendet, um durch die Modellierung des Bodenerosionspotenzials unter verschiedenen Bewirtschaftungsoptionen Interventionsstandorte im Feld zu bestimmen. Die relativ geringen Datenanforderungen des InVest-Modells und die Tatsache, dass es bei der Messung des Bodenerosionspotenzials sowohl die geophysikalischen als auch die ökologischen Merkmale des Gebiets berücksichtigt, machen das InVest-Modell für die EbA/Eco-DRR-Planung und für datenarme Länder sehr geeignet.
Gelernte Lektion
Die Erzielung von Mehrfachnutzen und die Erbringung greifbarer Nachweise dafür sind wichtig für die Akzeptanz in der Gemeinschaft. Vor dem Projekt waren die Holzkohleproduktion und die Brandrodung die Hauptaktivitäten. Die Landwirte waren mit der Agroforstwirtschaft nicht vertraut und hielten das für das Projekt ausgewählte Land für die Landwirtschaft für ungeeignet.
Der Gesamterfolg zeigte sich darin, dass die Gemeinschaft die Maßnahmen unter Anleitung erfahrener lokaler Partner sehr gut annahm und die Überlebensrate der gepflanzten Agroforstbäume hoch war (98 %).
Da es sich jedoch um Demonstrationsflächen handelte, waren Mitglieder der Gemeinschaft, die nicht ausgewählt wurden und somit keinen Zugang zu den Vorteilen hatten, unzufrieden. In einem Fall wurde absichtlich Feuer gelegt, um eine Aufforstungsfläche zu zerstören. Daher ist es wichtig, in Zukunft auf lokale Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen und sicherzustellen, dass die Projektvorteile so breit wie möglich verteilt werden, um Konflikte zwischen den Ressourcennutzern zu minimieren. Dies zeigt auch die Grenzen von Pilotprojekten auf.
Bekämpfung von Gullys und Bodenerosion
Die Verringerung der Erosion durch Gullys war wichtig, um die Verschlammung von Quellen und Bächen in niedrig gelegenen Gebieten und die Zerstörung der Infrastruktur zu verhindern. Um die Bildung von Gullys zu behandeln und zu stoppen, wurde im Rahmen des Projekts eine ingenieurbiologische Technik unter Verwendung von Vetiver eingesetzt, einem Gras, das für seine tiefen Wurzeln bekannt ist und die Bodenerosion wirksam bekämpfen kann. Bei dieser Methode werden mit Erde gefüllte Säcke in Gullys verdichtet, um das Fortschreiten der Gullys aufzuhalten. In die oberen, mit fruchtbarer Erde gefüllten Säcke wird Vetiver gepflanzt. Die Säcke zerfallen normalerweise in der Sonne, aber die Vetiverwurzeln halten den Boden an seinem Platz.
Auch Flussufer wurden mit Vetivergras stabilisiert, nachdem unebene Vorsprünge entfernt und die Böschung geglättet worden war. Zur Versorgung der beiden Arbeitsgebiete (in der Nähe der Wasseraufbereitungsanlage und in der Nähe von Kinshasa) wurden Vetiver-Baumschulen eingerichtet.
Ermöglichende Faktoren
Eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation in der Nähe von Kinshasa, wo nur begrenzte Flächen für Gemeinschaftsprojekte zur Verfügung stehen, stellte Platz für eine Vetiver-Baumschule zur Verfügung.
Gelernte Lektion
Der Einsatz von Vetiver zum Schutz vor Gullys und Bodenerosion war ebenfalls sehr erfolgreich, da die Anwohner den Schutzwert des Vetivergrases sofort erkannten, vor allem wenn sich die Flächen in der Nähe ihrer Häuser, Schulen oder öffentlichen Straßen befinden. Vor dem Projekt wussten die Gemeinden im Einzugsgebiet nichts von der Wirksamkeit von Vetivergras als Erosionsschutzmaßnahme. Jetzt haben die Nachbargemeinden großes Interesse an einer Nachahmung der Bioengineering-Methode gezeigt.
Aufbau von Kapazitäten
Da dies die erste Erfahrung der Demokratischen Republik Kongo mit der Anwendung sowohl des Öko-DRR- als auch des IWRM-Konzepts war, war es von entscheidender Bedeutung, die Kapazitäten im Laufe der Zeit schrittweise zu entwickeln und zu stärken, was Folgendes beinhaltete:
- Bewusstseinsschärfung;
- Schulungen und Workshops;
- Praktische Lernaktivitäten an den Demonstrationsstandorten;
- Feldbesuche und Studienreisen sowohl im Land als auch in der Region.
Es fanden insgesamt 71 Schulungen und Workshops statt. Diese umfassten allgemeine Sitzungen (Einführung und Präsentation), nationale Sensibilisierungsworkshops zu Öko-DRR und IWRM, Workshops zum IWRM, zur Rolle von Öko-DRR im IWRM und zur Aktionsplanung, Schulungen zur hydrometeorologischen Überwachung, zur Überwachung der Bodenerosion und zur Modellierung des Hochwasserrisikos, Schulungen zur Agroforstwirtschaft und zur Wertschöpfungskette sowie Schulungen zur Überwachung von Bodenverlusten und zum Bioengineering zur Verringerung der Bodenerosion.
Ermöglichende Faktoren
Im Rahmen des Projekts wurde die Bedeutung der Vernetzung der lokalen Gruppe AUBR/L mit den zuständigen Ministerien der nationalen Regierung und anderen Partnern hervorgehoben, deren Kapazitäten ebenfalls aufgebaut wurden, um die Nachhaltigkeit der Arbeit auf Dauer zu gewährleisten.
Das Projekt schuf auch neue Partnerschaften, die Studienreisen im Land und in der Region ermöglichten.
Gelernte Lektion
Ein großer Teil des Kapazitätsaufbaus fand vor Ort statt, als Teil des "Learning-by-doing" durch die Umsetzung der Maßnahmen vor Ort. Diese Schulungen sollten zwar die Maßnahmen vor Ort unterstützen, aber auch lokal verwaltete Systeme einrichten, die langfristig Bestand haben würden. Daher wurden die Schulungen auch entsprechend dem während der Projektdurchführung ermittelten Bedarf ergänzt. So wurde beispielsweise festgestellt, dass auch Kapazitäten für den Verkauf von Agroforstprodukten (und nicht nur für die Umsetzung der Agroforstwirtschaft) und für den Umgang mit Buschfeuern aufgebaut werden mussten, nachdem ein Feuer eine Aufforstungsfläche zerstört hatte.
Unterstützung der nationalen Interessenvertretung für ökosystembasierte Maßnahmen
Um die Regierung der Demokratischen Republik Kongo bei ihrem nationalen Übergang zum IWRM zu unterstützen, wurde ein Fahrplan für die Entwicklung einer nationalen Wasserpolitik entwickelt. Der Fahrplan umreißt die Hauptausrichtung und die notwendigen Schritte bei der Ausarbeitung der nationalen Wasserpolitik, die wichtigsten beteiligten Akteure, einen ersten Arbeitsplan und eine Strategie zur Mobilisierung von Mitteln. Auch die Katastrophenvorsorge wird in der Roadmap als vorrangiges Thema hervorgehoben, ebenso wie der Aufbau von Kapazitäten und die sektorübergreifende Koordination. Dieser Fahrplan ist von den IWRM-Erfahrungen in Lukaya beeinflusst und bezieht sich speziell auf die Katastrophenvorsorge und die Rolle der lokalen Gemeinschaften im IWRM.
Auf Wunsch der Regierung, die ein Interesse an der Einrichtung einer nationalen Plattform für die Katastrophenvorsorge hatte, wurde auch eine nationale Arbeitsgruppe für ökologische Katastrophenvorsorge gebildet.
Ermöglichende Faktoren
Durch die Vor-Ort-Demonstrationen, die Workshops und Schulungen wurde ein nationaler Dialog über Öko-DRR angestoßen.
Gelernte Lektion
Der Erfolg des Projekts bei der Sensibilisierung für Öko-DRR im Land wurde deutlich, als die Regierung der DRK die Initiative zur Förderung ökosystembasierter Ansätze während der vorbereitenden Diskussionen über den globalen Rahmen zur Katastrophenvorsorge für die Zeit nach 2015, jetzt Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), ergriff. Die Regierung der DRK hat sich die Förderung von Öko-DRR-Ansätzen durch IWRM voll zu eigen gemacht.
Auswirkungen
Die Boden- und Gullyerosion wurde an den Pilotstandorten gemildert, was das Hochwasserrisiko verringert. Starke Regenfälle im Jahr 2015, die während der Umsetzung in dem Gebiet auftraten, führten nicht zu einer Verschlimmerung der Gullys, was einen erfolgreichen Erosionsschutz belegt. Die Trinkwasserversorgung ist gesichert.
Die Gemeinden sind widerstandsfähiger, da sie über ein höheres Einkommen verfügen und ihre Lebensgrundlagen diversifizieren konnten (z. B. Bienenzucht und Obstbaumanbau). Das gemeinschaftsbasierte Agroforstsystem sorgt seit acht Jahren für neue Ernten von Kuhbohnen und Maniok, und der Verkauf von Holzkohle, die auf den gerodeten Agroforstfeldern erzeugt wird, hat das Einkommen der 20 beteiligten Haushalte erhöht.
Lokale und nationale Interessengruppen können ihre Bemühungen stärker auf die Katastrophenprävention konzentrieren und die vielfältigen Ursachen für die Verschlechterung der Ökosysteme im Lukaya-Becken angehen, die zum Katastrophenrisiko beitragen. Das Projekt führte zu einem stärkeren nationalen Engagement für die Einbeziehung von Öko-DRR in die nationale Entwicklungspolitik, einschließlich der Entwicklung der nationalen Wasserpolitik.
Begünstigte
1.400 Einwohner (Ntampa, Kasangulu, Kimwenza und Mafumba im Lukaya-Wassereinzugsgebiet) bei einer Gesamtbevölkerung von 80.000 im Lukaya-Einzugsgebiet.
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Geschichte

Das von 2013 bis 2016 im Einzugsgebiet des Lukaya-Flusses in Zusammenarbeit mit der Regierung der Demokratischen Republik Kongo, lokalen Gemeinschaften und akademischen Einrichtungen durchgeführte und von der Europäischen Kommission finanzierte Projekt zielte auf den Schutz und die Sanierung eines der wichtigsten Wassereinzugsgebiete für die Trinkwasserversorgung der sich ausbreitenden Hauptstadt Kinshasa ab. Neben dem Schutz der Trinkwasserversorgung befasst sich der integrierte Ansatz des Projekts mit mehreren zentralen Entwicklungsherausforderungen wie Existenzsicherung und Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit und Katastrophenvorsorge.
Die Association of the Users of the Lukaya River Basin (AUBR/L) war die wichtigste Durchführungsorganisation des Projekts, die zunächst gestärkt, bei der Erlangung ihrer Rechtspersönlichkeit unterstützt und umstrukturiert wurde. Die AUBR/L wurde bei der Entwicklung eines IWRM-Aktionsplans (2016-2018) unterstützt, der einen Fahrplan für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen im Lukaya-Wassereinzugsgebiet, einschließlich ökosystembasierter Maßnahmen, enthält.
Im Rahmen des Projekts wurde eine Reihe von ökosystembasierten Maßnahmen sowohl in flussaufwärts als auch in flussabwärts gelegenen Gebieten umgesetzt, die als Pilotprojekte für ökosystembasierte Maßnahmen zur Anpassung und Katastrophenvorsorge im Rahmen des IWRM-Ansatzes dienen:
Flussaufwärts: An der Quelle des Flusses in der Nähe des Dorfes Ntampa in der Provinz Kongo Central - Die Aktivitäten in diesem Gebiet konzentrierten sich auf die Begrünung durch gemeinschaftliche Agroforstwirtschaft und Wiederaufforstung, um die Bodenerosion und Sedimentation im Lukaya-Fluss an der Quelle zu verringern; Einrichtung von hydro-meteorologischen und Flussüberwachungsinstrumenten und eines Eco-DRR/IWRM-Informationszentrums.
Flussabwärts: Im Untereinzugsgebiet von Mafumba in der Nähe von Kinshasa, wo ein hohes Risiko für Bodenerosion und anarchische Verstädterung besteht, konzentrierten sich die Aktivitäten in Mafumba auf die Erprobung einer Methode zur Überwachung der Bodenerosion und die Kontrolle der Erosion von Gullys durch Bioengineering (mit Vetiver); in Kimwenza wurden Vetivergras und -bäume eingesetzt, um die Erosion der Flussufer zu kontrollieren und eine grüne Pufferzone bei der Wasseraufbereitungsanlage einzurichten. Auf dem Gelände der Wasseraufbereitungsanlage wurde auch das Büro des AUBR/L-Ausschusses für flussabwärts gelegene Gebiete eingerichtet.
Eine Reihe von Workshops und Schulungen wurden durchgeführt, um die Kapazitäten auf lokaler und nationaler Ebene zu erhöhen, und es fanden Feldbesuche und Studienreisen im Land und in der Region statt. All dies ermöglichte und unterstützte die Entwicklung der nationalen Wasserpolitik und ermöglichte die nationale und globale Politik zur Katastrophenvorsorge nach 2015.