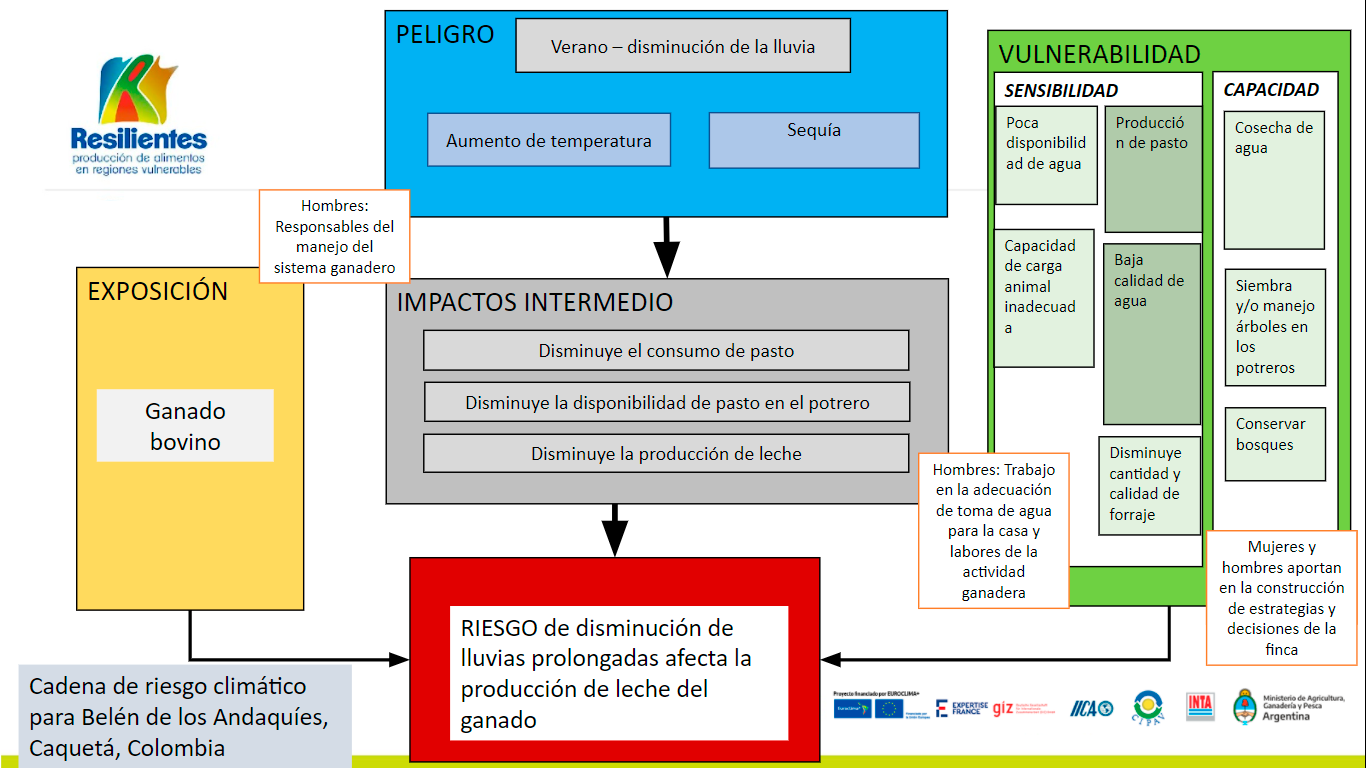Capacity Development Programm (CDP) zum Kooperationsmanagement für klimasensitives integriertes Wasserressourcenmanagement (IWRM) und EbA
Das 2019 in Kraft getretene thailändische Wasserressourcengesetz stärkt die Rolle der Flussgebietsausschüsse (River Basin Committees, RBCs) in den 22 thailändischen Flusseinzugsgebieten. Die RBCs - bestehend aus Vertretern verschiedener Behörden und Sektoren, Wassernutzerorganisationen, die die Zivilgesellschaft und den Privatsektor repräsentieren - sind nun die Hauptakteure bei der Multi-Stakeholder-Entwicklung der Masterpläne für die Flusseinzugsgebiete (RBMPs).
In der Folge entwickelten ONWR und GIZ ein umfassendes Kapazitätsentwicklungsprogramm (Capacity Development Programme, CDP), das darauf abzielt, die technischen und institutionellen Kapazitäten der RBCs zu stärken, um "klimasensitive Flussgebietsmasterpläne" zu entwickeln, die Anpassung an den Klimawandel und EbA als Leitprinzipien beinhalten.
Das CDP konzentriert sich auf zwei Hauptaspekte: Kapazitätsaufbau für (1) Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertungen und die Integration des EbA-Planungszyklus in die RBMP-Entwicklung und (2) "Management- und Planungsprozess-Moderation", die darauf abzielt, das Management- und Kommunikations-Know-how und die Fähigkeiten der Hauptakteure im RBMP-Prozess auf der Grundlage eines partizipativen Ansatzes zu stärken.
Um dieses Know-how aufrechtzuerhalten und zu erweitern, unterstützt das CDP auch die Entwicklung eines Pools von Ausbildern/Moderatoren und die Ausbildung von Ausbildern, die wichtige Fähigkeiten bei der RBMP-Entwicklung stärken.
Es wird erwartet, dass nach der vollständigen Umsetzung dieser Lösung das gesamte technische Wissen und die Fähigkeiten sowie die verbesserten Prozesse für die Auswahl, Gestaltung und Umsetzung von EbA bei den zuständigen Mitarbeitern und Organisationen gestärkt werden. Dies wird wesentlich dazu beitragen, die RBCs, das wichtigste Planungsgremium in Multi-Stakeholder-Flusseinzugsgebietsprozessen, mit den erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten, um klimasensible Bewirtschaftungspläne zu entwickeln, die zu einer verbesserten nachhaltigen Wasserbewirtschaftung in Thailand führen werden.