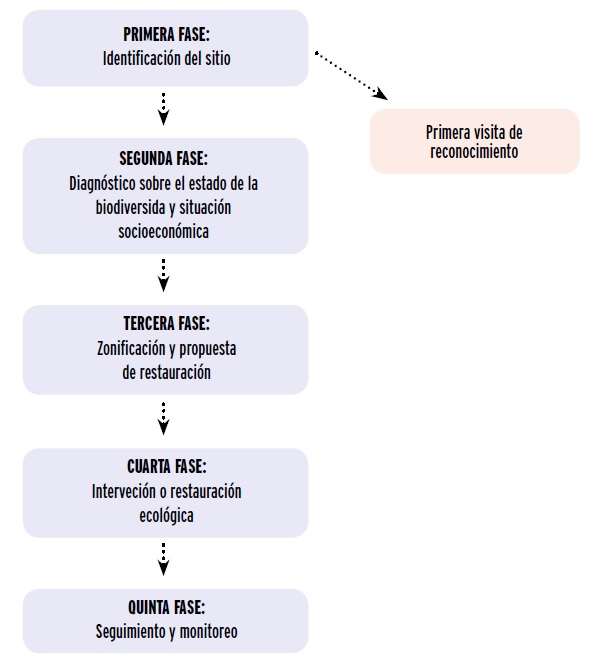Identifizierung und Analyse von Interessenvertretern/Analyse des Standortprofils.
Analyse und Identifizierung der Akteure/Stakeholder:
Um die Stakeholder im Projektgebiet zu verstehen, wurden alle Akteure im Distrikt, die die Einrichtung von LMMAs unterstützen können, nach ihrer Fähigkeit, zu dessen Umsetzung beizutragen, eingestuft. Die Einstufung erfolgte mit 1 bis 3 Punkten (1 - gering, 2 - mittel und 3 - hoch). Es wurden nur die Akteure ausgewählt, die eine Punktzahl von 3 erreichten, nämlich die Regierung, der Fischereirat der Gemeinde, Fischer, Fischerinnen, einflussreiche Mitglieder (Gemeinde- und Religionsführer) und Gruppen, die alternative Einkommensmöglichkeiten schaffen.
Die Beteiligten wurden dann durch die SAGE/IMET-Methoden, durch Einführungs- und Hintergrundworkshops und durch die Teilnahme an den Bewertungen selbst einbezogen.
Profil der Untersuchungsgebiete:
Charakterisierung des Untersuchungsgebiets, einschließlich der Art des Lebensraums, den wir schützen, der Arten, der Art des Schutzgebiets, das wir einrichten, d. h. zeitlich begrenzte und dauerhafte Schutzgebiete (zeitlich begrenzte Schutzgebiete für kurzlebige Arten, in diesem Fall Tintenfische, und zur Erhöhung des Haushaltseinkommens, und dauerhafte Schutzgebiete oder Wiederaufstockung zur Erhaltung der biologischen Vielfalt für künftige Generationen, was jedoch zu einem Überschwappen von Fischen in das Gebiet führen kann, in dem Fischfang erlaubt ist), Dimensionen der Schutzgebiete, rechtlicher Rahmen.
Zu den wichtigsten Faktoren, die diesen Baustein ermöglichen, gehört die Einbeziehung von Projektteammitgliedern, die die Gemeinden und Landschaften, in denen wir arbeiten, sehr gut kennen, um sicherzustellen, dass alle Interessengruppen identifiziert und dann richtig eingestuft werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Teammitglieder breit aufgestellt sind, um ein breiteres Spektrum an Meinungen über die Fähigkeit der Interessengruppen zur Umsetzung von LMMAs zu erhalten und darüber, wie sie am besten eingebunden werden können.
Um eine reibungslose Datenerhebung in den Fokusgruppen und bei den Interessenvertretern zu gewährleisten, ist es wichtig, (i) klare Fragen zu stellen und sicherzustellen, dass die Themen von allen gut verstanden werden, (ii) gegebenenfalls die für Übersetzungen benötigte Zeit zu berücksichtigen und (iii) Meinungsverschiedenheiten zuzulassen. Darüber hinaus musste die Konsultation mehrerer Interessengruppen (mit der Präsentation der Ergebnisse der IMET- und SAGE-Bewertungen) mehrmals wiederholt werden, um die Zustimmung aller Interessengruppen für die Ausarbeitung der Verbesserungspläne zur Verbesserung der LMMA-Ko-Managementpläne zu erhalten.