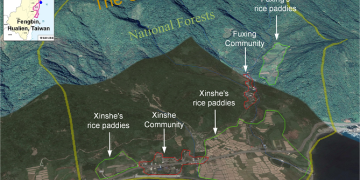Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Bewohner der Mafia-Insel und den Erfordernissen des Naturschutzes
Das MIMP wurde in erster Linie eingerichtet, um die biologische Vielfalt zu erhalten und die äußerst destruktiven Fischereipraktiken der Wanderfischer zu beenden. Es lag auch im Interesse der lokalen Fischer. Es war jedoch wichtig, die Bedürfnisse der Einwohner und ihre Abhängigkeit von den natürlichen Ressourcen zu berücksichtigen. So sorgten die Mitarbeiter des MPRU einerseits für den Umweltschutz und die Sensibilisierung für die Nutzung und Bewirtschaftung der Ressourcen und verbesserten andererseits die Infrastrukturen für Schulbildung, Gesundheit und Wasserversorgung. Die Gesetze werden auch gegenüber Straftätern und Gemeindemitgliedern, die sich nicht an die Regeln halten, durchgesetzt. Im Gegenzug werden die Dorfbewohner, die sich an die Regeln halten, ermutigt und gelobt.