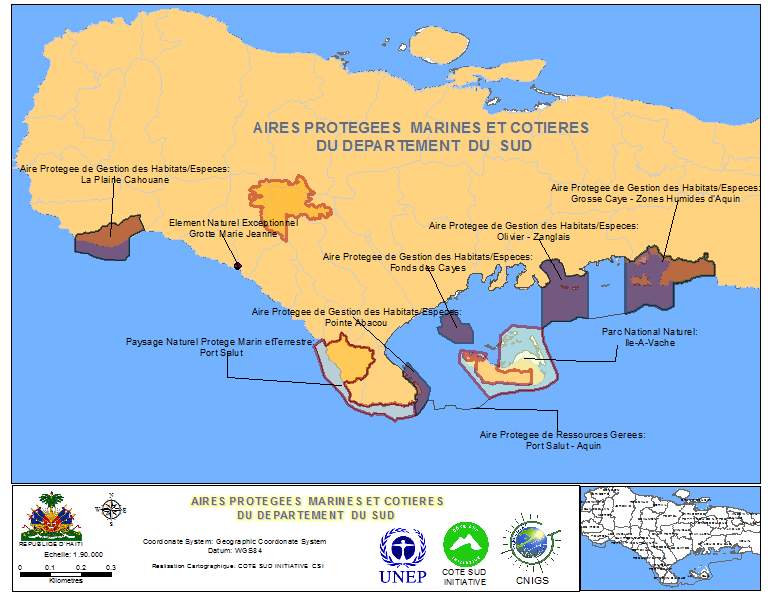Das Projekt investierte erheblich in den Aufbau von Kapazitäten auf lokaler und nationaler Ebene durch Sensibilisierung für EbA/Eco-DRR, praktische Lernaktivitäten vor Ort und Schulungsworkshops. Das Projekt stellte sicher, dass bei allen Aktivitäten auch Frauen geschult wurden.
Der Aufbau von Kapazitäten auf lokaler Ebene richtete sich hauptsächlich an die fünf Dörfer, in denen die Maßnahmen stattfanden, bezog aber auch Vertreter von Dörfern ein, die an der Ausweitung der Projektmaßnahmen auf ein größeres Gebiet des Wadis im flussaufwärts gelegenen Abschnitt beteiligt waren. Die Bewusstseinsbildung förderte den Dialog über Trockengebietsökosysteme und Fragen des Katastrophenrisikomanagements.
Aufgrund der begrenzten Präsenz der Regierung in den Dörfern wurden landwirtschaftliche Berater (2 in jedem Dorf) geschult, um landwirtschaftliche Beratungsdienste zu leisten. Darüber hinaus wurden acht kommunale Tiergesundheitshelfer, auch "Paravets" genannt, in theoretischen und praktischen Kursen in Tierhaltung, Behandlung, Tiermedikamenten, Fütterung und Impfung geschult. Die "Paravets" überwachten auch die neu eingesäten Weideflächen.
Außerdem wurden eine nationale und eine landesweite Schulung zum Thema Öko-DRR durchgeführt.
Der größte Teil des Kapazitätsaufbaus fand vor Ort statt, als Teil des "Learning by Doing" durch die Durchführung von Feldmaßnahmen wie die Einrichtung und Verwaltung von Baumschulen, die Wiedereinsaat von Weideflächen und die Wiederaufforstung.
Lokale Schulungen zum Aufbau von Kapazitäten in den Gemeinden verbessern die Chancen auf Kontinuität bei der Verwaltung der Feldeinsätze.
Der Workshop auf gesamtstaatlicher Ebene initiierte eine Reihe von Dialogen in Nord-Darfur über die Bedeutung der Einrichtung eines Forums, das als Plattform für die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen dient, die sowohl integrativ ist als auch die wasserbezogenen Gefahren berücksichtigt. Die Durchführung solcher Schulungen auf nationaler und gesamtstaatlicher Ebene trägt dazu bei, ökosystembasierte Maßnahmen in nationale Politiken und Programme einzubinden. In der Tat wurde IWRM als Schlüsselmaßnahme zur Verringerung von Katastrophenrisiken und zur Anpassung an den Klimawandel und an Wetterextreme identifiziert, was sich in der nationalen Aktionsagenda widerspiegelt, die das wichtigste Ergebnis der nationalen Schulung war.