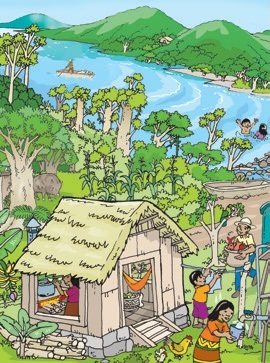Auf der Grundlage eines partizipativen Bottom-up-Prozesses wird ein wirksames, rechtlich anerkanntes und lokal respektiertes Netz von Fischschutzgebieten geschaffen. Seit 2012 wurden sechzehn Fischschutzgebiete mit einer Fläche von mehr als 18 000 Hektar geschaffen.
Das lokal-ökologische Wissen der Fischer über die natürlichen Ressourcen, die Fischgründe und die klimatischen Bedingungen sind grundlegende Elemente, die bei der Planung einer Fischauffangstation berücksichtigt werden müssen. Bei der Kombination von lokal-ökologischem Wissen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es wichtig, dass eine transparente Verhandlung beginnt, die es ermöglicht, die besten wissenschaftlich fundierten Bedingungen mit sozialer Akzeptanz zu erreichen.
Anschließend wird ein gemeinschaftliches Überwachungsprogramm von Organisationen durchgeführt, die Mitglieder der Kanan Kay Alliance sind. Fischer und Frauen werden geschult und beteiligen sich aktiv an der Datenerhebung. So sehen sie die Ergebnisse mit eigenen Augen und können die Informationen mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft teilen. Sobald die Überwachungsergebnisse vorliegen, werden die Ziele der Fischschutzgebiete während des Erneuerungsprozesses überprüft, um festzustellen, ob sie die biophysikalischen Kriterien für Nichtentnahmezonen erfüllen und ob daher Änderungen erforderlich sind.
Dieser "Bottom-up"-Ansatz muss durch "Top-down"-Elemente ergänzt werden, um sicherzustellen, dass die Entscheidungsfindung die Komplexität dieses Prozesses widerspiegelt.