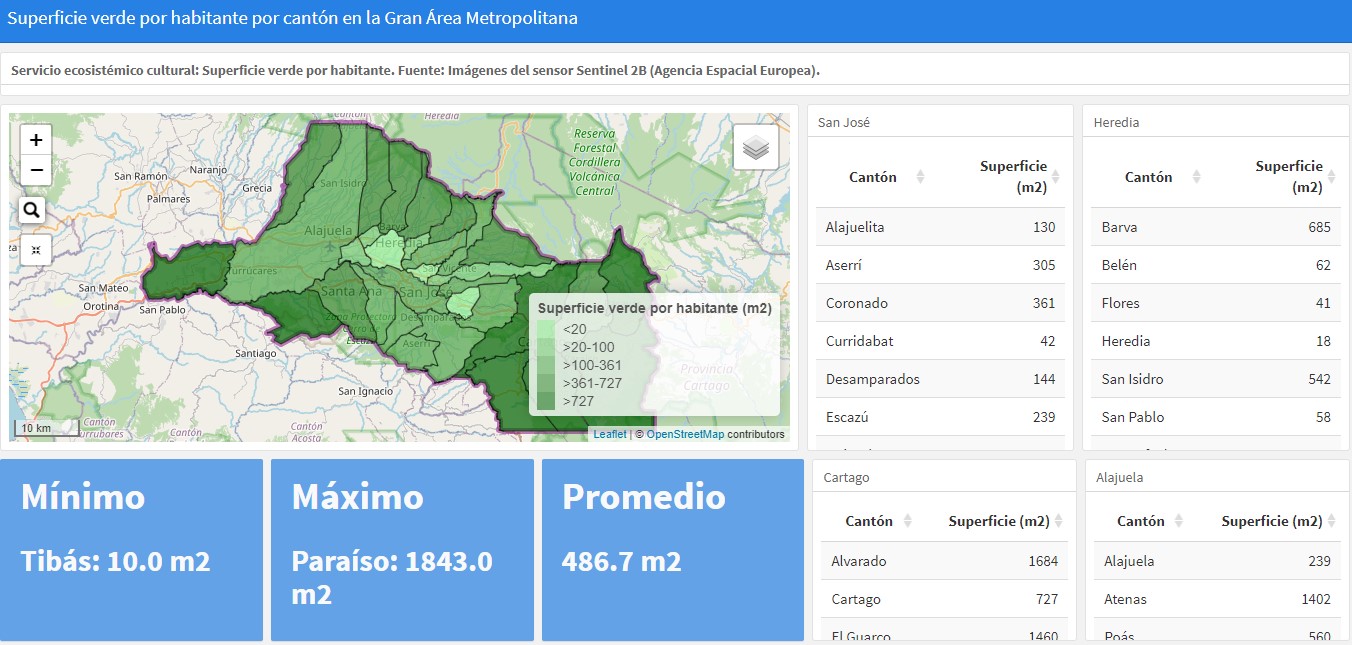Schaffung der Voraussetzungen für ein wertebasiertes und partizipatives Management, das eine nachhaltige Entwicklung unterstützt
In jüngster Zeit hat ein partizipatives Forschungsprogramm unter der Leitung des privaten Partners darauf hingearbeitet, dass die neue Denkmalschutzbehörde eine echte wertebasierte und partizipative Verwaltung des kulturellen Erbes fördern kann. Wenn man versteht, wer dem Erbe welche Bedeutung beimisst, kann man die Erhaltung der Stätte und die Bewältigung von Veränderungen in der Landschaft verbessern. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Beziehungen zum Welterbe und zu anderen Kulturgütern wurden kartiert, wodurch zuvor vernachlässigte Verbindungen und gegenseitige Abhängigkeiten sichtbar gemacht werden konnten.
Die Initiative arbeitet auch daran, die Kapazitäten innerhalb der Zivilgesellschaft, der Institutionen und der lokalen Fachleute für das Kulturerbe zu ermitteln, um einen Beitrag zur Kulturerbe-Agenda zu leisten, und geht damit über die klassische Kulturkartierung hinaus, um zu verstehen, was positive Veränderungen in einem breiten lokalen Netzwerk auslöst.
Die ersten greifbaren Ergebnisse sind georeferenzierte Instrumente zur Verbesserung der Entscheidungsfindung in Bezug auf Wandel und Kontinuität und zur Nutzung lokaler Kapazitäten in diesem Prozess. Das übergeordnete Ziel besteht darin, das gesamte Potenzial des Beitrags des Kulturerbes zur nachhaltigen Entwicklung in diesem schwierigen und komplexen Gebiet zu erfassen.
Diese Arbeit ist möglich, weil Herculaneum über einen langen Zeitraum hinweg auf mehreren Ebenen für die Aktivitäten und die Verwaltung der Stätte auf den Menschen ausgerichtet wurde. Dazu gehört die Einbeziehung zahlreicher Interessengruppen in die Ermittlung der Werte des Kulturerbes, die dann die Grundlage für das Verständnis der Verbindungen zwischen dem Kulturerbe innerhalb einer größeren Landschaft bilden. Dazu gehört auch, dass Herculaneum eine Rolle bei der Unterstützung lokaler nachhaltiger Entwicklungsbestrebungen in einer Weise spielt, die sowohl der lokalen Gemeinschaft als auch dem Kulturerbe selbst zugute kommt.