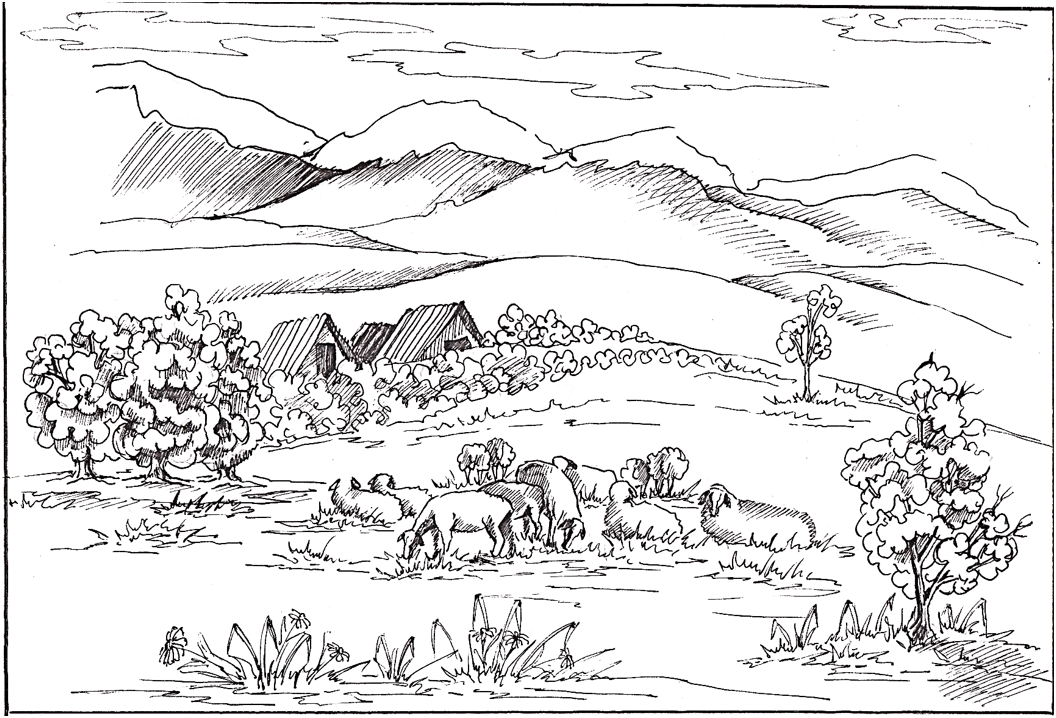Ein offener und partizipativer Prozess
Die preisgekrönten Entwürfe des Wettbewerbs werden am Tag der Pressekonferenz für den Lebensmittelwald ausgestellt
Wutong Foundation
Vorstellung des Entwurfs bei den lokalen Gemeinschaften
Wutong Foundation
Der Hsinchu Food Forest ist das Ergebnis eines offenen und partizipativen Prozesses zwischen der Stadtverwaltung und verschiedenen Akteuren der Stadt, wie Anwohnern, Gemeindegruppen, städtischen Behörden, Schulen und sogar denjenigen, die die Idee eines städtischen Lebensmittelwaldes zunächst vielleicht nicht gut finden. Um die Beteiligung und Unterstützung der Öffentlichkeit zu sichern, ist es wichtig, jeden Schritt des Aufbaus des Lebensmittelwaldes zu einem offenen und partizipativen Prozess zu machen. Wir haben über 30 Stunden lang Vorträge gehalten, um die lokalen und umliegenden Gemeinden über die Idee eines Lebensmittelwaldes aufzuklären. Wir haben sogar die Mitbegründer des Beacon Food Forest eingeladen, um ihre Erfahrungen mit der Stadtverwaltung und den Gemeinden zu teilen, was eine große Hilfe war, um die offiziellen Stellen dazu zu bringen, Ja zu sagen. Wir veranstalteten auch einen Wettbewerb, um die Ideen der Bürger für die Gestaltung des Geländes zu sammeln, und beauftragten später einen Landschaftsarchitekten, die Ideen der Gewinnergruppen zu kombinieren. Wir standen in engem Kontakt mit dem Verwaltungsbeamten und den örtlichen Gemeinden (und den Medien), um sicherzustellen, dass die Beteiligten über die neuesten Fortschritte des Lebensmittelwaldes informiert wurden, und um die Gestaltung rechtzeitig zu ändern, wenn jemand Bedenken äußerte, die nicht beachtet worden waren, z. B. dass Menschen stolpern und nachts in den Teich fallen könnten. Wir fügten eine kurze Hecke und eine Beleuchtung hinzu, um solche Möglichkeiten zu verhindern.
1. Eine Gruppe mit starken Anreizen zur Durchführung des Projekts, die mit verschiedenen Interessengruppen verhandeln und die Verantwortung übernehmen kann.
2. Eine offene und positive Einstellung, wenn sie mit Hindernissen und unterschiedlichen Meinungen konfrontiert wird.
3. Vollständiges und klares Verständnis des Projekts, möglicher Hindernisse und anderer Informationen durch alle Beteiligten.
4. Unterstützung durch alle Beteiligten/Gemeindemitglieder. Dies ist besonders wichtig, wenn das Projekt auf öffentlichem Grund durchgeführt wird.
5. Partizipative Gestaltung: Die Gemeinde muss ebenfalls konsultiert und in die Gestaltung des Standorts einbezogen werden.
Die Unterstützung des Grundeigentümers, insbesondere wenn es sich um die Stadtverwaltung handelt, ist für die Nachhaltigkeit des Projekts sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, viele Herausforderungen zu bewältigen und dem Projekt Legitimität zu verleihen. Während des Prozesses wird man mit Sicherheit auf unterschiedliche Meinungen oder Verhaltensprobleme stoßen, die manchmal vernünftig sind und manchmal nicht. Viele der Vorschläge, die von den Ältesten vor Ort vorgebracht wurden, widersprachen beispielsweise dem Konzept der "Sorge für die Erde" oder des "fairen Anteils", wie z. B. der Einsatz von Pestiziden zur Linderung von Schädlingsproblemen oder der Ausschluss von Personen, die sie nicht mögen, von der Teilnahme am Lebensmittelwald. Obwohl wir eine offene und positive Einstellung bewahren und versuchen, alle gleich und glücklich zu machen, fanden wir es schwierig, den Verhaltenskodex durchzusetzen, da wir weder Beamte noch Anwohner sind. Hier könnte die Stadtverwaltung eine Rolle bei der Koordinierung von Konflikten spielen und das letzte Wort haben. Beachten Sie, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist, wenn das Projekt in einem anderen kulturellen Umfeld durchgeführt wird.