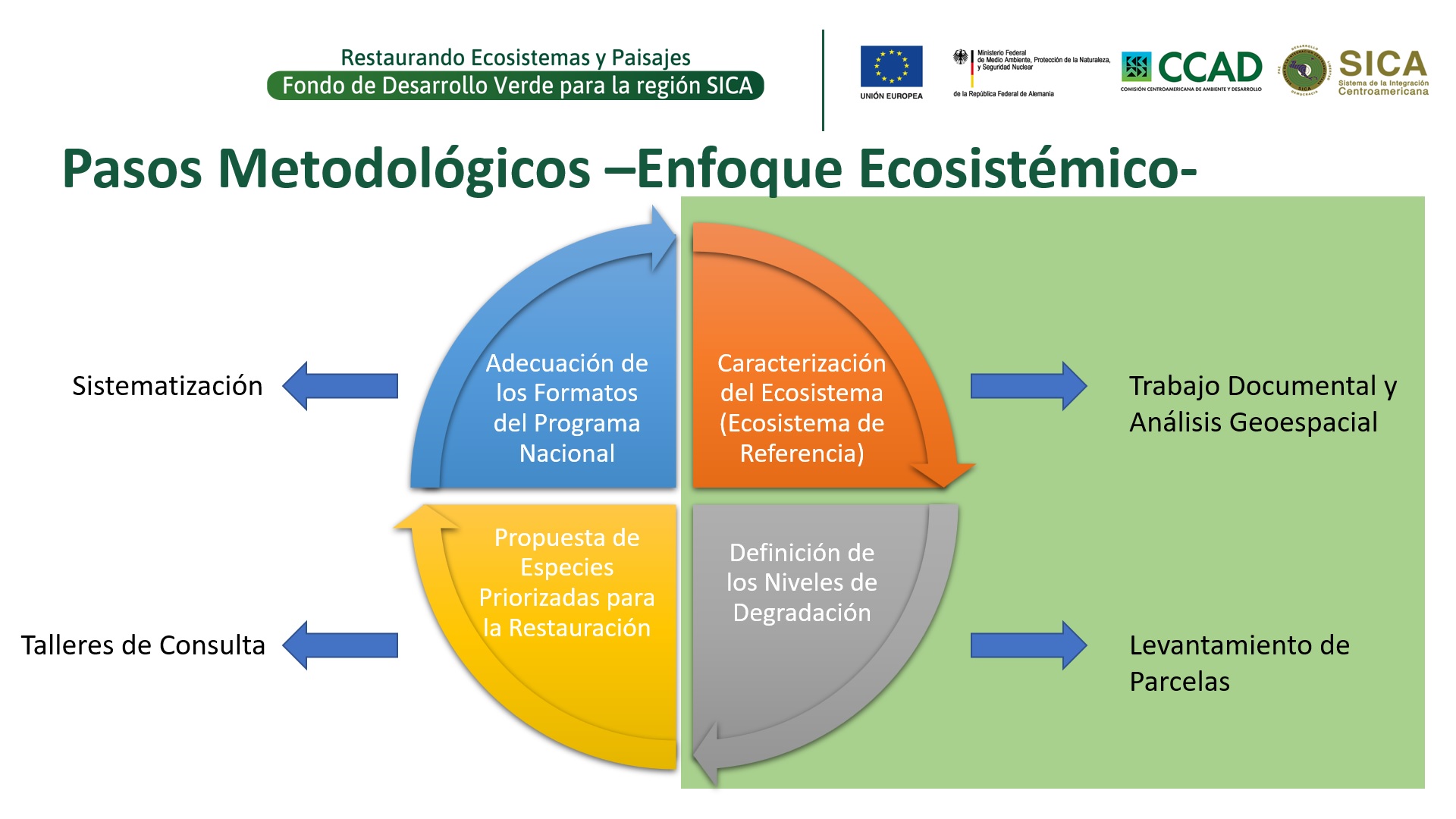Die Internationale Allianz hat derzeit 3 Arbeitsgruppen, die von den Mitgliedern selbst geleitet werden und vom Sekretariat der Allianz unterstützt werden. Jede Arbeitsgruppe wird von 1-2 Vorsitzenden geleitet, und die Gruppe trifft sich alle 6-8 Wochen, um einen kontinuierlichen Arbeitsprozess zu gewährleisten.
Derzeit gibt es die folgenden Arbeitsgruppen:
- Wissenschaft-Politik-Schnittstelle (Vorsitz: Sue Liebermann, WCS)
In Anbetracht unseres grundlegenden Verständnisses von Wildtieren wollen wir dieses Verständnis, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, in internationale politische Prozesse einfließen lassen.
- Transformativer Systemwandel: Das große Bild (Vorsitz: Alex D. Greenwood, IZW Berlin; Barabara Maas, NABU)
Es gibt grundlegende Hindernisse für die Erreichung der Ziele der Allianz. Diese zu identifizieren und anzugehen ist der Schwerpunkt dieser Arbeitsgruppe.
- Evaluation/Wirksame Interventionen (Vorsitz: Craig Stephen, One Health Consultant)
Ziel ist es, bewährte Verfahren für wirksame Interventionen von Allianzmitgliedern zu sammeln, um einen sektor- und regionenübergreifenden Lern- und Wissensaustausch zu ermöglichen.
Der Erfolg der Arbeitsgruppe hängt davon ab, ob klare Ziele formuliert wurden, wie engagiert und gut organisiert der Vorsitz ist, wie motiviert die Gruppenmitglieder sind und ob es einen kontinuierlichen Arbeitsablauf gibt.
Da die meisten Mitglieder bereits sehr anspruchsvolle Vollzeitbeschäftigungen haben, kann sich die zeitliche Kapazität der einzelnen Mitglieder im Laufe der Zeit ändern. Es kann eine Herausforderung sein, einen guten Arbeitsablauf und eine gute Arbeitsatmosphäre zu gewährleisten. Wertschätzung und Verständnis sind von großer Bedeutung, um eine weitere Zusammenarbeit zu ermöglichen.