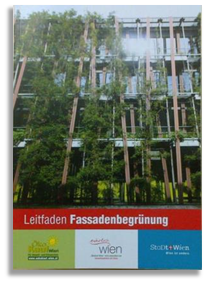Festlegung gemeinsamer grenzüberschreitender Bewirtschaftungsziele
Der erste Schritt besteht darin, die Interessengruppen zu ermitteln, die bei der Behandlung der Frage des grenzüberschreitenden Managements berücksichtigt werden sollten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mitarbeiter der Schutzgebiete selbst. Es wurden sechs Stakeholder-Gruppen identifiziert: Naturschutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus, Forschung sowie lokale Gemeinschaften und Gemeinden. Das Kernteam bestimmt dann bis zu 8 Vertreter der Interessengruppen, die in den Entscheidungsfindungsprozess einbezogen werden. Jede teilnehmende Parkbehörde identifiziert dann unabhängig 2-5 Anliegen und/oder Wünsche aus der Sicht jeder Interessengruppe. Als Nächstes wandelt jedes Kernteam die Wünsche und Anliegen in Zielsetzungen um, wobei zwischen Endzielen und Zwischenzielen, die nur Mittel zum Erreichen der Endziele sind, unterschieden wird. Anschließend wird eine reduzierte Gruppe von drei ultimativen, quantifizierbaren Zielen festgelegt, die die wichtigsten Kompromisse und Anliegen der Interessengruppen repräsentieren und gleichzeitig als Erfolgsmaßstab für die zentralen grenzüberschreitenden Erhaltungsmaßnahmen dienen. Die Konzentration auf eine kleinere Anzahl von Endzielen gewährleistet die Durchführbarkeit und Verständlichkeit der partizipativen Entscheidungsanalyse.
Um zu vermeiden, dass die Ziele und Interessengruppen von einem der beiden teilnehmenden Parks bestimmt werden, sollten die anfänglichen Listen der Interessengruppen und Ziele auf unabhängigen Beiträgen der Parkbehörden der beiden jeweiligen Parks in jeder Pilotregion beruhen. Eine Gruppe von mehr als 8 Vertretern der Interessengruppen (einschließlich der Parkbehörden) würde wahrscheinlich einen professionellen Moderator benötigen, und der hier beschriebene Prozess müsste erheblich modifiziert werden, um Fragen im Zusammenhang mit der partizipativen Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.
Die Parkbehörden hielten es für sinnvoll, die ursprünglich 18 Ziele in eine Hierarchie zu gliedern, um die Wechselbeziehungen zwischen den Zielen zu erkennen und die "Koexistenz von Bären und Menschen zu erhalten" als Endziel festzulegen. Für die Entscheidungsanalyse wählte das Team die folgenden Endziele: 1) Erhaltung der Tragfähigkeit der Bärenpopulation im grenzüberschreitenden Gebiet und darüber hinaus, 2) Erhaltung einer nachhaltigen Landwirtschaft im grenzüberschreitenden Gebiet und 3) Minimierung von Konflikten zwischen den Interessengruppen in Bezug auf das Bärenmanagement.
Die Hälfte der Teilnehmer des Workshops gab an, dass sie die Endziele klar verstanden haben und dass diese ihre Bedenken widerspiegeln. Einige Stakeholder gaben an, dass die folgenden Themen nicht ausreichend angesprochen wurden: die tatsächliche Anzahl der Bären, der Ökotourismus, die positiven Auswirkungen der Bären, die Beziehung zwischen dem Bärenmanagement und den lokalen Gemeinden, die ökologischen Anforderungen der Bären, die einschlägigen Vorschriften (auf nationaler und regionaler Ebene) und die praktischen Probleme des Alltags.